 |
 |
 |
  |

|
Großbrand im Zentrum Kevelaers
Das verheerende Feuer von 1881
![]()
Es war die
Karwoche im Jahr 1881, als die Innenstadt Kevelaer von einem
verheerenden Brand heimgesucht wurde. Am 14. April 1881 brach gegen 1.30
Uhr das Feuer aus und vernichtete zahlreiche Gebäude im Zentrum. Diese
Katastrophe führte schließlich zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr
in Kevelaer.
Wie war die politische und gesellschaftliche Lage im Vorfeld des großen
Brands?
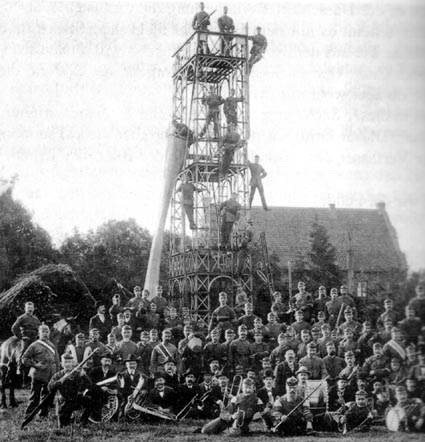 Zu
Beginn des Jahres 1880 stand vor dem beschlagnahmten
>
Priesterhaus
ständig ein Polizeiposten, argwöhnisch beobachtet von Kevelaerer
Bürgern, die ein Auge darauf hielten, ob sich jemand an Einrichtungen
des Priesterhauses vergriff. Der Kulturkampf in Preußen, unter
dem besonders die katholische Kirche zu leiden hatte, trieb seinem
Höhepunkt entgegen.
Zu
Beginn des Jahres 1880 stand vor dem beschlagnahmten
>
Priesterhaus
ständig ein Polizeiposten, argwöhnisch beobachtet von Kevelaerer
Bürgern, die ein Auge darauf hielten, ob sich jemand an Einrichtungen
des Priesterhauses vergriff. Der Kulturkampf in Preußen, unter
dem besonders die katholische Kirche zu leiden hatte, trieb seinem
Höhepunkt entgegen.
Der Feuerwehrturm bei Grevers-Sürgers nach der Wende zum 20. Jahrhundert.
Da traf die
für Kevelaer wichtigste Nachricht des Jahres ein: In Leipzig hatte das
Reichsgericht in einem Musterprozess die Ansprüche des Staates auf
Kirchenbesitz abgewiesen - ein Grundsatzurteil von weit reichender
Bedeutung: Der preußische Staat durfte nicht länger die Kirchengüter,
die Anfang des 19. Jahrhunderts unter französischer Regierung
konfisziert worden waren und die er den Kirchen lediglich zur Nutzung
überließ, als seinen Besitz betrachten. Die Kirchen waren in
Wirklichkeit die rechtmäßigen Eigentümer. Sämtliche Beschlagnahmungen,
die auf Grund des Gesetzes von 1875 auch im Rheinland verfügt und
durchgesetzt worden waren, wurden vom Reichsgericht als nicht
gerechtfertigt erklärt.
Für Kevelaer bedeutete es: Das Priesterhaus, dessen erste Beschlagnahme
im Kulturkampf durch Besitzübertragung vom Bistum Münster auf
die Kevelaerer Pfarrgemeinde verhindert worden war, gehörte nun auf der
Grundlage dieses höchstrichterlichen Urteils zum Besitz der
St.-Antonius-Pfarrgemeinde.
Im Bereich des Kevelaerer Friedhofs stand ein altes, verwittertes Kreuz.
>
Wilhelm Brügelmann, der protestantische Bürgermeister in der
Marienstadt, ließ es im Jahr 1880 als Verwalter des Armenvermögens, zu
dem das Grundstück gehörte, durch eine Kreuzigungsgruppe ersetzen, die
in der Werkstatt des Kölner Bildhauers E. Renard geschaffen worden war.
Zu diesem Zeitpunkt hatte die dort wachsende Linde bereits ein Alter von
rund 200 Jahren erreicht.
Eine Reihe von neuen Geschäften belebte die Innenstadt Kevelaers.
Ferdinand Hammans zeigte Anfang 1880 der Bevölkerung im Kävels Bläche
an, dass er sich im Hause des Uhrmachers Hermann Gruyters niedergelassen
habe: „Empfehle ein reichhaltiges Lager in gold. und silb. Anker- und
Cylinder-Uhren, Remonteur-Regulateuren, und Schwarzwälder-Uhren zu
billigen Preisen. Reparaturen werden schnell und solide ausgeführt.“
Kevelaers Bäcker bildeten Anfang Februar ein Preiskartell und legten
fest, dass sie künftig für das Backen von Wecken statt 10 nun 15 Pfennig
verlangten. Ferner sollten in Zukunft acht Brötchen 25 Pfennig und 60
Stück Zwieback 50 Pfennig kosten.
Derweil schickten Glasmaler aus dem ganzen Reich Modelle für Fenster der
Marienkirche nach Kevelaer. Sie wurden in der
>
Beichtkapelle ausgestellt,
und interessiert nahmen die Bürger Anteil an dem Auswahlverfahren. Die
große Ausgestaltung der heutigen Basilika stand bevor.
 Da
schlug - am 24. Juni 1880 - abends um halb zehn der Blitz in den Turm
der St.-Antonius-Kirche ein.
Da
schlug - am 24. Juni 1880 - abends um halb zehn der Blitz in den Turm
der St.-Antonius-Kirche ein.
Zwischen Gründung der Feuerwehr und diesem Gruppenbild (1935) liegen Jahrzehnte.
Die
Turmspitze geriet in Brand, den niederprasselnder Regen dämpfte. Zwei
der acht eichenen Balken, die sich in der Spitze vereinigten, wurden vom
Blitz gespalten und fortgeschleudert, so dass sie den Schornstein über
der Sakristei zertrümmerten und die Kirchhofsmauer teilweise
beschädigten. Teile der Bleibekleidung des Turmhelms fand man in der
Gegend verstreut; einige Bleistücke hatten die Ziegeldächer benachbarter
Häuser durchschlagen. Das Turmkreuz stand noch, der abgesprengte Hahn
aber lag demoliert auf der Erde. Zu zwei Dritteln war die
Schiefereindeckung des Turms verloren. Glocken und Uhrwerk blieben
unbeschädigt.
In den Niederungen des alltäglichen Umgangs der protestantisch geprägten
Regierung mit der durchweg katholischen Bevölkerung im Rheinland ging
der kulturkämpferische Kleinkrieg, für den ein Fall aus Kervenheim
bezeichnend war, weiter. Die Wohnung des evangelischen Pfarrers von
Kervenheim, vor elf Jahren „ganz nach den Wünschen des Predigers und
unter Berücksichtigung der Familien-Verhältnisse desselben eingerichtet
und restaurirt“, sollte erneut verändert und vergrößert werden. Die
Zivilgemeinde war gesetzlich dazu verpflichtet, solche Pfarrwohnungen zu
bauen und zu unterhalten. Der Gemeinderat lehnte den Antrag der
evangelischen Kirchengemeinde im Sommer 1880 einstimmig ab; die
Ausbauwünsche seien völlig überzogen. Sogar ein Badezimmer wolle der
Pfarrer haben. Regierung und Oberpräsidium sahen das anders und
bestanden darauf, dass das Pfarrhaus auf Kosten der Zivilgemeinde wie
beantragt ausgebaut würde - gegebenenfalls zwangsweise und gegen den
Willen der Ratsmitglieder.
Die neue Marienkirche, die heutige Basilika, stand immer noch ohne Turm
da. Der Kirchenvorstand wollte zur Finanzierung den Holzbestand einer
Waldparzelle verkaufen, aber die Regierung intervenierte: Das zu
verkaufende Holz dürfte frühestens zehn Jahre nach der Inspizierung
durch die Behörde geschlagen werden. Damit war die Verwertung des
kirchlichen Holzbesitzes auf lange Zeit torpediert.
Derweil freute sich die katholische Bevölkerung in Wetten über
Restaurierung und Verschönerung ihrer St.-Petrus-Pfarrkirche, die im
Oktober 1880 abgeschlossen wurde. Kirchenmaler Lang aus Aachen, bereits
in Straelen und Sonsbeck bewährt, hatte die Wand über dem Triumphbogen
am Chorabschluss mit der Darstellung des jüngsten Gerichts ausgemalt.
Es nahte die Karwoche und mit ihr der große Brand von Kevelaer. Am 14.
April 1881 brach gegen 1.30 Uhr auf der Dorfstraße Feuer aus, das in
kurzer Zeit zwei Scheunen zerstörte und dann auf ein mit Reet gedecktes
Gartenhäuschen sprang. Bei heftigem Südostwind erfassten die Flammen
Häuser an der Nordseite des Kapellenplatzes, wo vier Geschäftshäuser mit
sämtlichen Hintergebäuden eingeäschert wurden, zwei weitere brannten im
Oberstock aus. Der Wind trieb das Feuer weiter: Fast die Hälfte der
Häuser an der heutigen Busmannstraße gingen zu Grunde, ein zweistöckiges
Haus in der Maasstraße brannte aus. Im Ganzen wurden elf Gebäude und
mindestens so viele Scheunen und Stallungen zerstört, 14 weitere Gebäude
mehr oder weniger stark beschädigt. Ein Mann, Vater von vier Kindern,
kam in den Flammen ums Leben.
Ungezählte Bürger der Gemeinde halfen und eilten mit Ledereimern,
gefüllt mit Löschwasser, herbei. Auf Handkarren wurden Wasserfässer und
andere Gefäße herbeigerollt. Das Wasser wurde aus den Nachbarpumpen
geschöpft.
Der unzureichende Feuerschutz wurde jedem Einwohner klar. Die
Verwüstungen waren zwar schon wenige Wochen nach dem Großfeuer
weitgehend aus dem Blickfeld, aber jetzt wurde systematisch die Gründung
einer Feuerwehr vorbereitet, zu der es im Frühherbst 1885 auch kommen
sollte.
Der Brand eröffnete neue Möglichkeiten in ganz anderer Hinsicht. In
Kevelaer freute man sich schon auf die schöneren Gebäude, die nunmehr
auf den Ruinengrundstücken am Kapellenplatz gebaut werden konnten. Die
Küstereistraße [Busmannstraße] wurde nach Abriss der ausgebrannten
Häuser verbreitert. Zwischen Kapellenplatz und Küstereistraße, wo
die Geschwister Meyvorts Besitz hatten, sollte ein Platz unbebaut
bleiben - Voraussetzung für den späteren Luxemburger Platz. Dieser nun
freie Bereich wurde als großer Fortschritt empfunden, weil der
Kapellenplatz stark umbaut war und, wie es in einem zeitgenössischen
Bericht des KB heißt, ...
„...allmälig fast unheimlich werden und ein düsteres Gepräge bekommen [könnte], wenn von keiner Seite ein Blick in's Freie möglich wäre. Wir bezeichnen es daher als einen sehr glücklichen Griff, daß der Herr > Pastor van Ackeren die Meyvort'sche Besitzung käuflich an sich gebracht, und so dafür gesorgt hat, daß sie nicht in Privatbesitz gelangt ist. Wir zweifeln nämlich nicht daran, daß der Ankauf dieser Besitzung nicht für Privatzwecke erfolgt ist, und daß dieselbe früher oder später in das Eigentum einer Corporation gebracht werden soll. Man faselt zwar Allerlei über diesen Ankauf. Die Leute, welche solche Faseleien in die Welt bringen, und an solche Schwätzereien glauben, beurtheilen Andere und sich selbst, und können es nicht begreifen, daß es auch Menschen auf Gottes Erdboden gibt, welche nicht bloß an das eigene Interesse denken und nicht immer nur für den eigenen Geldsack sorgen.“
![]()
![]()