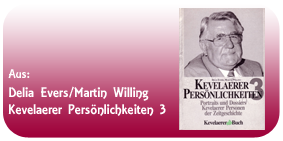|
 |
 |
  |

|
Cremeren, Gerhard
Bürgermeister von Kevelaer im Kulturkampf | * 1797 | † 1881
![]()
 Eine unglaublich lange Zeit, von keinem seiner Vorgänger oder Nachfolger
erreicht, wirkt Gerhard Cremeren als Chef des
>
Rathauses in Kevelaer. Er
ist von 1822 bis 1875 hauptamtlicher Bürgermeister der Marienstadt und
zugleich ihr Standesbeamter - 53 Jahre lang. Vom preußischen Staat wird
er zwangspensioniert, nicht etwa, weil er zu diesem Zeitpunkt schon 78
Jahre alt ist, sondern weil der engagierte Katholik die staatlichen
Repressalien gegen die Kirchen nicht mittragen kann. Das ist zu Anfang
des Kulturkampfes noch anders...
Eine unglaublich lange Zeit, von keinem seiner Vorgänger oder Nachfolger
erreicht, wirkt Gerhard Cremeren als Chef des
>
Rathauses in Kevelaer. Er
ist von 1822 bis 1875 hauptamtlicher Bürgermeister der Marienstadt und
zugleich ihr Standesbeamter - 53 Jahre lang. Vom preußischen Staat wird
er zwangspensioniert, nicht etwa, weil er zu diesem Zeitpunkt schon 78
Jahre alt ist, sondern weil der engagierte Katholik die staatlichen
Repressalien gegen die Kirchen nicht mittragen kann. Das ist zu Anfang
des Kulturkampfes noch anders...
Die Kevelaerer beginnen sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
unter preußischer Verwaltung einzurichten. Der Staat bricht in
Privilegien der Kirche ein und übernimmt beispielsweise die
Schulerziehung in seine Verantwortung. Die in katholischer Tradition
verwurzelten Eltern schicken ihre Kinder nun in eine „Staatsschule“ - in
die Marktschule, die während der Amtszeit von Gerhard Cremeren 1848
gebaut wird - etwa dort, wo heute das neue Rathaus steht.
Katholisches Selbstbewusstsein in Kevelaer drückt sich anders aus. Der
1858 von dem Kölner Diözesanbaumeister Vincenz Statz begonnene Bau der
neugotischen Wallfahrtskirche und heutigen Basilika ist ein starkes
Symbol für die Entschlossenheit der Katholiken, sich im Europa der
radikalen Brüche und tiefen Einbrüche zu behaupten. Das katholische
Milieu wehrt sich kraftvoll gegen den Staat, als beispielsweise der
preußische Kultusminister gegen die Jesuiten vorgeht (1852),
unterschätzt aber das Ausmaß der bevorstehenden politischen und
kirchlichen Veränderungen, die im Verlust des Kirchenstaates (1870)
gipfeln.
Nach Verkündigung des Mariendogmas von der Unbefleckten Empfängnis am 8.
Dezember 1854 durch Pius IX. bilden sich allerorten Marienvereine, so
auch in Kevelaer. Hier wird 1855 die Marianische Jünglings-Sodalität
gegründet, ein frommer Verein für engagierte Vorkämpfer der
Marienverehrung, die nunmehr der Herz-Jesu-Bewegung folgt, die das Leben
vieler Katholiken in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt hat.
Kevelaer entwickelt sich zu einem der Vorposten überaus konservativer,
katholischer Kräfte, die als „Ultramontane“ im Rheinland und in Preußen
neue Geistesströmungen bekämpfen, unter denen der politische
Liberalismus besonders populär ist. Die „Truppe“ steht, das katholische
Lager ist, wie Ergebnisse politischer Wahlen für unseren Raum beweisen,
geschlossen. Und es fühlt sich machtvoll gestärkt: Aus Frankreich werden
Marienerscheinungen berichtet, 18 an der Zahl vom 11. Februar bis 16.
Juli 1858, erlebt von einem Mädchen namens Bernadette Soubirous. Einen
Monat später, am Fest Mariä Himmelfahrt, ist feierliche Grundsteinlegung
für die Marienkirche in Kevelaer durch Bischof Johann Georg Müller. Erst
im Jahr darauf, und auch das kennzeichnet den quälend langen Übergang
vom Mittelalter „im Kopf“ zur Neuzeit, wird in Italien die Inquisition
abgeschafft. Rom wird von italienischen Truppen besetzt und am 20.
September 1870 zur Hauptstadt Italiens ausgerufen. Der Kirchenstaat ist,
bis auf das unmittelbare vatikanische Zentrum, aufgelöst. In Deutschland
gibt sich der politische Katholizismus eine übergreifende Parteistruktur
und gründet, um die innere Freiheit der Kirche zu verteidigen, 1870 das
Zentrum.
Kurz zuvor wird am Niederrhein eine Eisenbahnlinie fertiggestellt
(1868). Kevelaer, der Wallfahrtsort, hat seitdem einen Bahnhof.
Bürgermeister Gerhard Cremeren und die Wallfahrtsleitung begrüßen diese
entscheidende Verbesserung der Infrastruktur sehr. Mit ihr beginnt der
zweite große Aufschwung der Kevelaer-Wallfahrt seit Einsetzung des
Gnadenbildes.
Aber schon bald ist die Welt in Aufruhr. Das von Bismarck gezielt
provozierte Frankreich erklärt 1870 Preußen den Krieg. Bismarcks
Rechnung geht auf: Seine Truppen marschieren bis Paris durch, und in
Abwesenheit des 63-jährigen Kaisers Napoleon III. erklären die Franzosen
ihr Land zur Republik. Ausgerechnet im Feindesland, in Versailles, wird
am 18. Januar 1871 aus 25 Bundesstaaten das Deutsche Reich gegründet mit
König Wilhelm von Preußen als deutschem Kaiser an der Spitze und Otto
von Bismarck als Reichskanzler.
Unmittelbar nach Friedensschluss, als das Ruhrgebiet in seinem rasanten
industriellen Aufstieg Arbeiter wie ein Magnet anzieht, geben sich in
Kevelaer die Warenaufkäufer aus dem Revier die Klinke in die Hand:
Massenhaft werden Schuhe gebraucht. Die Schuhfabrikation Kevelaers
erlebt ihr goldenes Zeitalter.
Obschon auch die Katholiken die Gründung des Deutschen Reichs (dem sich
bald die süddeutschen Länder anschließen werden) als den Beginn der
Neuzeit bejubeln, sind sie Bismarck so suspekt, dass er sie als die
wahren Reichsfeinde empfindet und gegen sie einen „innenpolitischen
Präventivkrieg“ anzettelt. Seine rüden Maßnahmen gegen Katholiken, ihre
Kirche und deren Einrichtungen ab 1871 haben allerdings auch den
einkalkulierten Nebeneffekt, dass die liberalen Mehrheitsgruppen im
deutschen Reichstag und im preußischen Landtag vollauf mit dem Kampf
gegen die katholische Kirche beschäftigt sind und Bismarck auf den
Hauptfeldern der Politik weniger hineinregieren.
Schon am Vorabend des Kulturkampfes bricht in Kevelaer, ausgelöst durch
den Deutsch-Französischen Krieg, der Pilgerstrom ein. Aber mit der
Reichsgründung, so hofft die Wallfahrtsleitung in Unkenntnis der
bevorstehenden Kulturkampf-Beschränkungen, soll sich die Lage
normalisieren. Im selben Jahr beginnt der Geistliche Stanislaus
Aenstoots seine Arbeit als Chordirektor des Musikvereins Kevelaer, den
er in den nächsten 23 Jahren zu einer unersetzlichen Stütze im
kirchlichen und kulturellen Leben der Marienstadt ausbaut. Ebenfalls
1871 werden die ersten
>
Vorsehungsschwestern nach Kevelaer entsandt, wo
sie die Haushaltsführung des Priesterhauses übernehmen und mit der
Ausbildung von Lehrköchinnen beginnen.
Im Deutschen Reich herrscht Aufbruchstimmung. Gewaltig dehnen sich die
Industrien aus, und im Aufwärtstaumel dieser Gründerzeit setzt ein
„Jahrhundert-Aufschwung“ ein. Ungezählte Unternehmen in Deutschland
werden in dieser Zeit auf die Beine gestellt, in Kevelaer unter anderen
der >
graphische Betrieb Bercker (1870) und die Devotionalienfabrik
Wehling (1871).
Im Wirtschaftsboom der Gründerjahre wachsen krasse Gegensätze zwischen
Arm und Reich, im Morgenwind des Politikaufbruchs prallen Liberalismus
und tradierter Katholizismus unversöhnlich aufeinander, im Chaos der
Zerrissenheit verlieren viele Menschen den geistigen Haltepunkt für ihr
Leben. Die Auflösung des Kirchenstaates wird im katholischen Volk
verwechselt mit einem Generalangriff auf ihre heilige Kirche. Unkritisch
wird absolutistische Macht, die aus der vergangenen Welt des
Mittelalters stammt, wie ein von Gott gewährtes Privileg des Papstes
überhöht. Was selbst aufgeklärte Menschen in Deutschland für ihre eigene
monarchische Reichsstruktur längst nicht mehr akzeptieren, gilt in ihren
Augen für die Ausnahme des römischen Herrschers unverändert fort. Der
Papst wird von ihnen nicht in seiner faktischen Doppelrolle als
geistliches Oberhaupt der katholischen Kirche einerseits und
absolutistischer Herrscher über einen profanen Staat andererseits
wahrgenommen, sondern als ganzheitliche Leitfigur, die nicht irren kann.
Dass der Verlust seiner weltlichen Macht ein Segen für Papsttum und
Kirche ist, wird erst im 20. Jahrhundert weitgehend verstanden.
Im Kraftfeld der marianischen Bewegungen in Europa häufen sich, nach
Lourdes (1858) und vor dem Kirchenstaat-Ende (1870),
Marienerscheinungen: Aus Österreich, Frankreich, Italien, Kroatien,
Belgien, aus der Schweiz und den USA werden etwa 20 Fälle von
Marienerscheinungen berichtet. Kirchliche Anerkennung findet aber nur
jene, die wenige Monate nach der weltlichen Entmachtung des Papstes am
17. Januar 1871 in Pontmain in Frankreich geschieht: Einem zwölfjährigen
Bauernjungen und seinem kleinen Bruder (10) erscheint die Gottesmutter
in einem königlichen Gewand mit einer hohen Krone; die Kinder sehen dann
vor Maria ein großes blutiges Kreuz mit dem Gekreuzigten und den
traurigen Blick der Gottesmutter.
Kevelaer, das mit seiner Stiftung der marianischen Jünglingssodalität
(1855) bereits zu Beginn einer Gründungswelle marianischer Vereine im
Rheinland Kampfbereitschaft gezeigt hat, steht unerschütterlich zu
seiner Kirche, die es durch die Vorgänge in Italien bedroht sieht. Der
überzeugte Katholik Gerhard Cremeren gründet 1868 - zwei Jahre vor dem
Verlust des Kirchenstaates - zusammen mit Gräfin Mathilde von
Hoensbroech einen Unterstützungsverein für den bedrängten Papst. Nach
dem Fall Roms fördert er mit der Autorität seiner Person den auch in
Kevelaer formierten Protest der Katholiken gegen die, wie sie empfinden,
„Unterdrückung Roms“. Als im Oktober 1871 eine große Bittwallfahrt
zugunsten von Pius IX. in Kevelaer organisiert wird, steht Bürgermeister
Cremeren in der vorderen Reihe der Veranstalter.
Dem von der Regierung abhängigen Bürgermeister ist die Gratwanderung
bewusst. Sein öffentliches Auftreten gestaltet er so, dass er dem Staat
keine Angriffsflächen bietet. Seine Lage wird immer schwieriger, als
sogar den Geistlichen im „Kanzelparagraphen“ vom 10. Dezember 1871
verboten wird, sich zu Angelegenheiten des Staates zu äußern, wenn dies
„in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise“ geschieht, was
aus Sicht der Regierenden immer droht, sobald ein Katholik nur den Mund
aufmacht. Mit Empörung nehmen die Katholiken im Juli 1872 das Verbot des
Jesuitenordens auf. 560 Unterschriften werden allein in Kevelaer gegen
diese neuerliche staatliche Zwangsmaßnahme gegen den Katholizismus
gesammelt.
Jesuiten finden Unterschlupf in den niederländischen Besitztümern der
geldrischen Adelshäuser von Loe, Hoensbroech und Schaesberg. Die
Pfarrgemeinden lassen sich nicht unterkriegen. In St. Antonius Kevelaer
wird 1873 ein Kirchenchor gegründet, im selben Jahr auch einer in der
gleichnamigen Kervenheimer Pfarrei.
Höhepunkt und Ende des Kulturkampfes, den der preußische Staat bald
ergebnislos ausklingen lässt, fallen im Sommer 1873 mit dem plötzlichen
Niedergang der europäischen Wirtschaft zusammen, die in überzogen
euphorischer Gewinnerwartung der Gründerjahre weit über den
tatsächlichen Bedarf hinaus investiert hat.
Firmenzusammenbrüche und Entlassungen großen Ausmaßes sind die ersten
Folgen. Hoffnung machen den arbeitslosen Industriearbeitern die neuen
Bergwerke Rheinpreußen bei Homberg, die 1872 die ersten 85 Tonnen
Steinkohle zutage fördern.
Kaum ein anderes Kulturkampf-Gesetz trifft die katholische Welt so hart
wie das vom 11. Mai 1873, das dem Staat ein Vetorecht bei der Besetzung
von geistlichen Ämtern einräumt. Mit breitester Unterstützung der
Katholiken lehnen die deutschen Bischöfe dieses Gesetz rundweg ab und
boykottieren es. Geistliche, die ohne Zustimmung des Staates ihr Amt
ausüben, werden verhaftet oder mit Geldstrafen belegt. Fünf Geistliche
aus dem Kreis Geldern werden verbannt.
In diesem aufgeheizten politischen Klima wird Kevelaer zu einem
zentralen Ort der Festigung der Katholiken im Glauben. Vor mindestens
25.000 Pilgern predigt am 6. Oktober 1873 der Mainzer Bischof
>
Wilhelm
Emmanuel von Ketteler in der Marienstadt, analysiert den Kulturkampf als
eine Hass-Attacke des Staates gegen Christus, beschwört die Einheit der
Kirche und legt, indem er die Kevelaerer unter den Pilgern direkt
anspricht, den Katholiken die Marienverehrung besonders ans Herz.
Die Predigt liefert bei aller Deutlichkeit keinen Ansatz für staatliche
Repressionen.
Kevelaers Bürgermeister Cremeren, der der Regierung berichten muss,
stuft das Großereignis in Kevelaer als eine Veranstaltung mit „streng
kirchlichem Charakter“ ein; auch die katholischen Vereine seien hier
frei von politischer Agitation. Cremeren fühlt sich zunehmend eingeengt.
Als er im Sommer 1874 kommunale Begrüßungsveranstaltungen für
Weihbischof Bossmann erlaubt - der Besuch eines Bischofs löst
traditionell umfangreiche Aktivitäten auch im vorkirchlichen Raum aus -,
pfeift ihn die Regierung Düsseldorf zurück und widerruft die Erlaubnis
im Nachhinein.
Gerhard Cremeren, der betagte Bürgermeister von Kevelaer, wird der
ständigen Auseinandersetzungen mit der Regierung müde und kämpft nun mit
offenem Visier. Als die Düsseldorfer ihren Behinderungen des
Wallfahrtslebens die Spitze aufsetzen und heuchlerisch vorgeben, Pilger
müssten vor den „sittlichen Gefahren“ solcher Reisen bewahrt werden,
platzt dem 78-jährigen Bürgermeister der Kragen. Die Sittlichkeit sei
das Letzte, das während einer Wallfahrt gefährdet werde. Und er gibt der
Regierung den dringenden Rat, sich endlich sachkundig zu machen, wenn
sie schon nicht auf seine über 50-jährige Erfahrung hören wolle.
Am 1. Juni 1875, einen Tag nach Cremerens Protestbrief nach Düsseldorf,
bittet er um seine Entlassung in den Ruhestand, die unverzüglich
vollzogen wird. Cremeren wird für einige Wochen durch den Beigeordneten
Risbroeck vertreten, dann im August durch den Protestanten
>
Brügelmann
ersetzt. Als Pensionär wirkt Cremeren noch einige Jahre im
Kirchenvorstand und in der Partei des Zentrums mit, für das er auch in
den Gemeinderat und den Kreistag Geldern gewählt wird. Eine wesentliche
Beraterrolle für die Kirche spielt er bis 1881 bei den Prozessen gegen
die Beschlagnahme kirchlicher Besitztümer in der Marienstadt.
Gerhard Cremeren, 1797 geboren, stirbt im Februar 1881 in Kevelaer.
„Obwohl noch rüstig an Geist und Körper“, schreibt das Kävels Bläche in
einem Nachruf am 26. Februar 1881, „trat er doch im Jahre 1875 in den
wohlverdienten Ruhestand, weil er glaubte, daß sein katholisches
Gewissen mit den Anforderungen des Culturkampfs in Conflict gerathen
könnte. Er ruhe in Frieden!“
![]()