 |
 |
 |
  |

|
Hungerwinter
1946/47
► "Das achte Kriegsjahr" - Tausende Menschen verhungerten oder erfroren
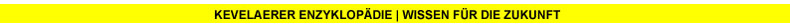
Hier auf dem Land, im Raum Kevelaer, traf der Hungerwinter 1946/47 die Menschen nicht ganz so vernichtend wie die Bürger in den Großstädten des Ruhrgebiets.
Ab Mitte Dezember 1946 fielen die Temperaturen ins Bodenlose. Während der zweiten Friedensweihnacht zitterten die Menschen in unbeheizten Notunterkünften bei 20 Grad Frost. Brennmaterial gab‘s nicht. Winterkleidung gab‘s nicht. Nahrung gab‘s nicht. Der Strom wurde abgestellt, Wasserleitungen froren zu. Schulen stellten den Unterricht ein.
Was die mehr als 60.000 Einwohner des Kreises Geldern auf Lebensmittelkarten bekamen, war grausam wenig - zeitweilig unter 800 Kalorien am Tag. Im Ruhrgebiet war es noch schlimmer. Stadtbewohner versuchten auf dem Land, Lebensmittel von Schwarzmarkthändlern zu erstehen. Rigoros verfolgte die Militärbehörde die „Ausfuhren“ aus dem Kreis Geldern, die verboten waren. Am Bahnhof Kevelaer, wo streng kontrolliert wurde, spielten sich jeden Tag erschütternde Szenen ab. Die armen Menschen schrien und weinten, wenn ihnen die wenigen organisierten Kartoffeln weggenommen wurden.
Selbst im ländlichen Kreis Geldern, wo man im Hungerwinter Essbares leichter beschaffen konnte als in den Zentren, hatte die anhaltende Unterernährung schlimme Folgen: Von 1.200 untersuchten Schulkindern waren 1.000 gesundheitlich angeschlagen, davon 200 schwer.
Ganz Deutschland hungerte und fror. Stuttgart zum Beispiel versuchte mit 70 Wärmestuben für 50.000 Menschen, seinen Einwohnern wenigstens für ein paar Stunden am Tag zu helfen. Wer alt oder krank war, durfte seine Wärmflasche mit heißem Wasser füllen, bevor er in sein kaltes Heim zurückging.
 Am
31. Dezember 1946 gab der Kölner Erzbischof Joseph Kardinal
Frings in seiner Predigt in der Kirche St. Engelbert seinen Landsleuten
moralischen Halt: Kleine Diebstähle der Hungernden und Frierenden seien
gerechtfertigt, wenn nur genommen würde, was der Einzelne für sich
selber brauche. Das „Organisieren“ von Brennmaterial und Nahrung hieß
fortan „Fringsen“.
Am
31. Dezember 1946 gab der Kölner Erzbischof Joseph Kardinal
Frings in seiner Predigt in der Kirche St. Engelbert seinen Landsleuten
moralischen Halt: Kleine Diebstähle der Hungernden und Frierenden seien
gerechtfertigt, wenn nur genommen würde, was der Einzelne für sich
selber brauche. Das „Organisieren“ von Brennmaterial und Nahrung hieß
fortan „Fringsen“.
Kardinal Josef Frings.
Niemand konnte sich vorstellen, dass es noch schlimmer kommen würde. Aber es kam schlimmer: Die dritte Frostwelle im Januar 1947 verwandelte das Land in eine eisige Hölle. Nun froren auch Flüsse und Kanäle zu. Schiffe lagen fest, Eisenbahnen fuhren nicht mehr: Die Versorgung brach völlig zusammen. An Kleidung für die notleidende Bevölkerung des Kreises Geldern hatte die Verwaltung nur noch drei Unterhemden und zwei Unterhosen zu vergeben. Man sprach im besetzten Deutschland bereits vom „achten Kriegsjahr“.
In Kevelaer versuchte die Verwaltung im Januar 1947, die geplatzten Hauptanschlussleitungen der Wasserversorgung reparieren zu lassen. Die Bürger wurden aufgerufen, Altmetall zu sammeln und dem Rathaus zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe dieser Rohstoffe sollten die Leitungen geflickt werden.
Derweil gingen im Ruhrgebiet die Hungernden auf die Straße. Der „Hungermarsch der Essener Betriebe“ brachte 10.000 Menschen vor das Rathaus. „Wir haben Hunger!“, skandierten sie. „Wir wollen Brot!“
Die ungezählten Menschen, die die Not nicht überlebt hatten, wurden vielerorts fast vier Monate lang zwischengelagert. Erst ab März, als der Frost nachließ, konnte die Erde für Bestattungen aufgebrochen werden.
Die Hungersnot spitzte sich nun noch weiter zu. Mit Streiks und Demonstrationen in den Großstädten wurde von der britischen Militärverwaltung verlangt, den Menschen endlich zu helfen und die humanitäre Katastrophe zu stoppen. Nichts passierte - allerdings schritten die Briten auch nicht gegen die verbotenen Streiks ein.
Und es kam noch schlimmer. Nach der arktischen Kälte entwickelte sich der heißeste Sommer seit Jahrzehnten - mit Temperaturen bis 40 Grad im Schatten. Die Natur verdorrte. Von den Feldern „ernteten“ die Bauern nur die Kartoffeln, die sie gesetzt hatten.
Die Wende wurde am 5. Juni 1947 eingeläutet: Vor Studenten der Harvard-Universität skizzierte der amerikanische Außenminister George C. Marshall seine Vorstellungen von einem Hilfsprogramm für Europa. Der Marshallplan, im April 1948 in den USA verabschiedet, nützte allen: den notleidenden Völkern in Europa, der Abwehr des kommunistischen Einflusses im Westen und der amerikanischen Industrie, die Abnehmer für ihre Überproduktion fand.
► "Das achte Kriegsjahr" - Tausende Menschen verhungerten oder erfroren
Hier auf dem Land, im Raum Kevelaer, traf der Hungerwinter 1946/47 die Menschen nicht ganz so vernichtend wie die Bürger in den Großstädten des Ruhrgebiets.
Ab Mitte Dezember 1946 fielen die Temperaturen ins Bodenlose. Während der zweiten Friedensweihnacht zitterten die Menschen in unbeheizten Notunterkünften bei 20 Grad Frost. Brennmaterial gab‘s nicht. Winterkleidung gab‘s nicht. Nahrung gab‘s nicht. Der Strom wurde abgestellt, Wasserleitungen froren zu. Schulen stellten den Unterricht ein.
Was die mehr als 60.000 Einwohner des Kreises Geldern auf Lebensmittelkarten bekamen, war grausam wenig - zeitweilig unter 800 Kalorien am Tag. Im Ruhrgebiet war es noch schlimmer. Stadtbewohner versuchten auf dem Land, Lebensmittel von Schwarzmarkthändlern zu erstehen. Rigoros verfolgte die Militärbehörde die „Ausfuhren“ aus dem Kreis Geldern, die verboten waren. Am Bahnhof Kevelaer, wo streng kontrolliert wurde, spielten sich jeden Tag erschütternde Szenen ab. Die armen Menschen schrien und weinten, wenn ihnen die wenigen organisierten Kartoffeln weggenommen wurden.
Selbst im ländlichen Kreis Geldern, wo man im Hungerwinter Essbares leichter beschaffen konnte als in den Zentren, hatte die anhaltende Unterernährung schlimme Folgen: Von 1.200 untersuchten Schulkindern waren 1.000 gesundheitlich angeschlagen, davon 200 schwer.
Ganz Deutschland hungerte und fror. Stuttgart zum Beispiel versuchte mit 70 Wärmestuben für 50.000 Menschen, seinen Einwohnern wenigstens für ein paar Stunden am Tag zu helfen. Wer alt oder krank war, durfte seine Wärmflasche mit heißem Wasser füllen, bevor er in sein kaltes Heim zurückging.
 Am
31. Dezember 1946 gab der Kölner Erzbischof Joseph Kardinal
Frings in seiner Predigt in der Kirche St. Engelbert seinen Landsleuten
moralischen Halt: Kleine Diebstähle der Hungernden und Frierenden seien
gerechtfertigt, wenn nur genommen würde, was der Einzelne für sich
selber brauche. Das „Organisieren“ von Brennmaterial und Nahrung hieß
fortan „Fringsen“.
Am
31. Dezember 1946 gab der Kölner Erzbischof Joseph Kardinal
Frings in seiner Predigt in der Kirche St. Engelbert seinen Landsleuten
moralischen Halt: Kleine Diebstähle der Hungernden und Frierenden seien
gerechtfertigt, wenn nur genommen würde, was der Einzelne für sich
selber brauche. Das „Organisieren“ von Brennmaterial und Nahrung hieß
fortan „Fringsen“. Kardinal Josef Frings.
Niemand konnte sich vorstellen, dass es noch schlimmer kommen würde. Aber es kam schlimmer: Die dritte Frostwelle im Januar 1947 verwandelte das Land in eine eisige Hölle. Nun froren auch Flüsse und Kanäle zu. Schiffe lagen fest, Eisenbahnen fuhren nicht mehr: Die Versorgung brach völlig zusammen. An Kleidung für die notleidende Bevölkerung des Kreises Geldern hatte die Verwaltung nur noch drei Unterhemden und zwei Unterhosen zu vergeben. Man sprach im besetzten Deutschland bereits vom „achten Kriegsjahr“.
In Kevelaer versuchte die Verwaltung im Januar 1947, die geplatzten Hauptanschlussleitungen der Wasserversorgung reparieren zu lassen. Die Bürger wurden aufgerufen, Altmetall zu sammeln und dem Rathaus zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe dieser Rohstoffe sollten die Leitungen geflickt werden.
Derweil gingen im Ruhrgebiet die Hungernden auf die Straße. Der „Hungermarsch der Essener Betriebe“ brachte 10.000 Menschen vor das Rathaus. „Wir haben Hunger!“, skandierten sie. „Wir wollen Brot!“
Die ungezählten Menschen, die die Not nicht überlebt hatten, wurden vielerorts fast vier Monate lang zwischengelagert. Erst ab März, als der Frost nachließ, konnte die Erde für Bestattungen aufgebrochen werden.
Die Hungersnot spitzte sich nun noch weiter zu. Mit Streiks und Demonstrationen in den Großstädten wurde von der britischen Militärverwaltung verlangt, den Menschen endlich zu helfen und die humanitäre Katastrophe zu stoppen. Nichts passierte - allerdings schritten die Briten auch nicht gegen die verbotenen Streiks ein.
Und es kam noch schlimmer. Nach der arktischen Kälte entwickelte sich der heißeste Sommer seit Jahrzehnten - mit Temperaturen bis 40 Grad im Schatten. Die Natur verdorrte. Von den Feldern „ernteten“ die Bauern nur die Kartoffeln, die sie gesetzt hatten.
Die Wende wurde am 5. Juni 1947 eingeläutet: Vor Studenten der Harvard-Universität skizzierte der amerikanische Außenminister George C. Marshall seine Vorstellungen von einem Hilfsprogramm für Europa. Der Marshallplan, im April 1948 in den USA verabschiedet, nützte allen: den notleidenden Völkern in Europa, der Abwehr des kommunistischen Einflusses im Westen und der amerikanischen Industrie, die Abnehmer für ihre Überproduktion fand.
![]()