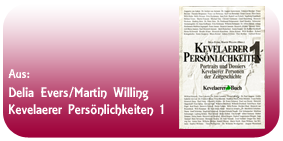|
 |
 |
  |

|
Kösters, Johann
Heimatdichter aus Wetten | * 1897 | † 1987
![]()
 Als
>
Gregor Vos 1937 die Melodie für das Wettener Heimatlied komponierte,
umspielten seine Töne die 1928 geschaffenen Strophen eines
Heimatdichters, der zum Nestor der rheinischen Mundartschriftsteller
werden sollte: Johann Kösters aus Wetten.
Als
>
Gregor Vos 1937 die Melodie für das Wettener Heimatlied komponierte,
umspielten seine Töne die 1928 geschaffenen Strophen eines
Heimatdichters, der zum Nestor der rheinischen Mundartschriftsteller
werden sollte: Johann Kösters aus Wetten.
Johann Kösters, 1897 in Wetten geboren, von Beruf Fabrikant, war
Mitarbeiter der geschichtlichen Beilage Unsere Heimat und Redakteur des
Wettener Heimatbriefes „Uet ons Derp“, der den Soldaten an der Front
nachgeschickt wurde. Ihn wählte der Gemeinderat zum Stellvertreter des
ersten Bürgermeisters nach Kriegsende (Matthias Selders). Kösters, dem
das Schützenwesen am Herzen lag, wurde erster Dekanatsbundesmeister der
Bruderschaften im Dekanat Kevelaer (1951) und später zum Ehrenminister
seiner St.-Petrus-Bruderschaft ernannt. Als Präsident der Geselligen
Vereine Wetten arbeitete er von 1950 bis 1967 und wurde anschließend ihr
Ehrenpräsident.
Johann Kösters war der Schöpfer der Idee, das Gemeindesiegel nach
Vorlage des von ihm 1952 aufgespürten ältesten Schöffensiegels der
„Alten Herrlichkeit Wetten“ (1390) zu gestalten. Und er wirkte als
Spielleiter von Theatergruppen einheimischer Vereine - alles zusammen
machte Kösters zum Großmeister seiner Heimat, die ihn „Pittöhm“ nannte.
Er war die Verkörperung dessen, was die Wettener unter Heimatliebe
verstehen und empfinden, und jemand, zu dem man aufschaute - ein
Vorbild, das Orientierungshilfe gab. Generationen von Wettenern wuchsen
mit seinem Heimatlied „Ek sin al völ gevare“ auf.
Wette
Ek sin al vööl gevare, dör’t Leven op on neer
on koam na Wetten ömmer et allerlifst wer weer.
Soog ek de Kerktorn wenke, dan wor ek nimmer müj,
on wenn die Klokke lüjde, dann schlug min Hart so blij.
Hier sin sön stelle Stroate, die Mensse al so gud,
on boave schwävd den Hemmel in Vür on Sonneglud.
Hier drage sej tesame ör Leed on dagliks Krüs;
hier werke sej on viere in Veld on Burenhüs.
Hier brukt sech nit te schame, de Man met schweele Hand,
hier brannen düsend Harte vör Kerk on Vaderland.
Wän’t Onglöck kömt geschreje, dan ston sej almool op
on sin näs Brürs on Sösters in häl’ge Noberschop.
Wor guje Mensse wone, dor sin ek altid geern,
so rein näs kloare Oge löcht genne Mergesstern.
On mot ek ok noch wandle, dör’t Leven op on af:
te Wette lot mej sterve on rösten ok in’t Graf!
![]()