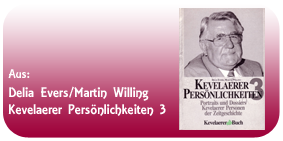|
 |
 |
  |

|
Meiners, Bernhard
Schulrektor in Kervenheim | * 1923 | † 2008
![]()
 Der
Lebensweg von Bernhard Meiners beginnt 1923 in Dortmund-Mengede. 1928
zieht die Familie nach Erwitte in Westfalen, weil der Vater, ein
Mittelschullehrer, dorthin versetzt worden ist. Der begabte Bernhard ist
erst 17, als er am Realgymnasium im März 1941 seine Reifeprüfung ablegt
- mitten im Krieg. Wenig später sind die meisten seiner Mitschüler
bereits eingezogen, ihre Berufswünsche bleiben unerfüllt.
Der
Lebensweg von Bernhard Meiners beginnt 1923 in Dortmund-Mengede. 1928
zieht die Familie nach Erwitte in Westfalen, weil der Vater, ein
Mittelschullehrer, dorthin versetzt worden ist. Der begabte Bernhard ist
erst 17, als er am Realgymnasium im März 1941 seine Reifeprüfung ablegt
- mitten im Krieg. Wenig später sind die meisten seiner Mitschüler
bereits eingezogen, ihre Berufswünsche bleiben unerfüllt.
Bernhard Meiners und seine
Frau Toni.
Bernhard will studieren und Ingenieur werden. Stattdessen verschickt der
braune Staat den Jungen in den Reichsarbeitsdienst, zunächst nach
Ostpreußen, dann nach Rußland. Hier wartet eine Knochenarbeit: Das
russische Schienennetz Richtung Leningrad wird für den deutschen
Nachschub gebraucht, doch die Schienenspuren sind anders als im Westen
und müssen angepasst werden. Bernhard Meiners: „Allerdings war das Netz
nur genagelt, es war nicht schwer, die Teile auseinanderzubekommen“.
Ende Oktober wird er aus seiner Einheit entlassen, und er hat Zeit, ein
halbes Jahr ein Praktikum in einer Metallverarbeitungsfirma zu machen.
Er lernt zu schweißen und zu fräsen. In dem Betrieb gibt es eine
Abteilung, in der sich fünf Leute darauf spezialisieren, streng
abgeschirmt ausschließlich Aluminium zu verarbeiten - ein neuer,
kriegswichtiger Werkstoff für die Flugzeugindustrie.
Im April 1942 kommt Bernhard Meiners zur Flak, wird am Nordostsee-Kanal
eingesetzt, später in Tschechien, in Ungarn und zum Schluss auf einem
sehr kleinen Flughafen irgendwo zwischen Leipzig und Dresden. Diesen Ort
hat er später nie wieder auf einer Karte finden können.
Als den Soldaten dort klar wird, dass Deutschland den Krieg nicht mehr
gewinnen kann, „beten wir, dass die Amerikaner vor den Russen
einmarschieren“. So kommt es; und Bernhard Meiners kehrt - körperlich
unversehrt - in den Westen zurück.
Soll er Ingenieur werden? Oder Lehrer wie sein Vater? Ein Onkel rät
entgeistert: „Um Gottes Willen nicht Ingenieur. Deutschland ist
gepflastert mit Ingenieuren“. Sein Vater rät: „Um Gottes Willen nicht
Lehrer“. Er weiß, wie Lehrer für politische Zwecke missbraucht worden
sind. Da sagt ein britischer Soldat zum jungen Bernhard: „Das
Erziehungswesen in England liegt nach dem Krieg im Argen. Ich will
Lehrer werden, um es mit aufzubauen“.
Bernhard Meiners wird Lehrer. Vier Semester in Paderborn reichen. Drei
Tage vor Weihnachten 1948 bekommt er den schriftlichen Bescheid: In
Düsseldorf liegen seine Papiere. Er ist für den Niederrhein eingeteilt.
Kleve, Geldern und die Wallfahrtsstadt Kevelaer sind ihm ein Begriff.
Doch von dem Dörfchen, in dem er arbeiten soll, hat er nie etwas gehört:
Kervenheim.
Er fragt sich, wie er sich hier, kurz nach dem Krieg, am besten über
Wasser halten kann und quartiert sich in einem Bauernhof ein, um sich
„gut im Futter zu halten“. Dreieinhalb Jahre bleibt er auf dem Hatershof
der Familie van Elst. Im Juni 1952 bezieht er eine Lehrerwohnung im
Obergeschoss des Schulgebäudes, das damals noch an der Wallstraße liegt
(dort wo heute gegenüber der Gaststätte Verhoeven Parkplatz und
Spielplatz sind). Bereits drei Jahre später, im April 1955, wird er zum
kommissarischen Schulleiter ernannt.
Dieses Jahr 1955 bringt ein weiteres Ereignis: Im Oktober heiratet
Bernhard Meiners seine
![]() Toni, geborene Schäfer, die die Kinder Bernhard
(* 1957) und Hildegard (* 1961) zur Welt bringen wird.
Toni, geborene Schäfer, die die Kinder Bernhard
(* 1957) und Hildegard (* 1961) zur Welt bringen wird.
Unterdessen wird die alte Schule an der Wallstraße abgerissen. Bernhard
Meiners erinnert sich, wie sehr viele Kervenheimer darunter leiden. Das
Dorf ist nach dem Krieg zu 85 Prozent zerstört, doch die Schule ist
beinahe unversehrt geblieben. „An der Mauer der Gaststätte Verhoeven
lehnen beim Abriss alte Männer“, sagt der Schulleiter. Sie weinen und
trauern nicht nur um ein Stück heile und im Krieg heilgebliebene Welt,
sondern auch um ein Stück eigener Geschichte, die abgebrochen wird,
obwohl die Bomben sie verschont haben.
Der Umzug von der alten in die neue Schule wird für den 29. September
1956 geplant. „Ein krummes Datum“, finden viele. „Ein bewusst gewähltes
Datum“, sagt Bernhard Meiners. Es ist der Tag des Heiligen Michael, der
das Böse in die Hölle stürzte, der Patron der Armen Seelen und des
deutschen Volkes. Die Schule wird auf den Namen des Heiligen Norbert von
Xanten getauft, dessen Familie nur wenige Kilometer von Kevelaer
entfernt in Gennep zu Hause war. Auch nach dem Umzug haben die
Schülerklassen Kompaniestärke. Bernhard Meiners unterrichtet 69 Kinder
auf einen Schlag. Andere Klassen sind noch größer.
Im Jahr darauf, 1957, wird Meiners zum Hauptlehrer befördert. 1970 macht
ein Erlass alle Schulleiter, die mindestens drei Klassen „unter sich“
haben, zu Rektoren. Meiners hat damals vier. Er bleibt Rektor bis Mitte
1987, dem Tag seiner Pensionierung.
Anders als seine Frau Toni gehört Bernhard Meiners keiner Partei an.
„Erkennbar war ich politisch tätig“, sagt er in einem Gespräch mit
![]() Delia Evers - nicht parteipolitisch, sondern gesellschaftspolitisch,
als Erzieher von Kindern. Parteien liegen ihm nicht. Das begründet er
so: Das Wort Partei leitet sich vom lateinischen Wort „pars“ ab,
bedeutet Teil, Parteien stünden immer nur für einen Teil, könnten nicht
für das Ganze sprechen.
Delia Evers - nicht parteipolitisch, sondern gesellschaftspolitisch,
als Erzieher von Kindern. Parteien liegen ihm nicht. Das begründet er
so: Das Wort Partei leitet sich vom lateinischen Wort „pars“ ab,
bedeutet Teil, Parteien stünden immer nur für einen Teil, könnten nicht
für das Ganze sprechen.
Wo er sich einsetzt, setzt er sich ganz ein. Zum Beispiel als Organist.
Weit über 30 Jahre übernimmt er zunächst vertretungsweise und ab 1990
hauptberuflich die Organistentätigkeit an St. Antonius Kervenheim - für
den „Hauptberuf“ gibt es lediglich eine kleine Entschädigung.
Es gibt eine weitere Tätigkeit, die Meiners ehrenamtlich ausübt. Er
lässt sich in den Geschichtskreis einbinden. Schon in der Schule hat er
mit Hilfe eines sehr guten Geschichtslehrers den Blick in die
Vergangenheit schätzen gelernt. Als
![]() Theo Kothes gemeinsam mit anderen Bürgern den Heimat- und
Verschönerungsverein Kervenheim-Kervendonk gründet, „hat man mich als
den ausgeguckt, der eine Chronik für das Dorf erstellen soll“.
Theo Kothes gemeinsam mit anderen Bürgern den Heimat- und
Verschönerungsverein Kervenheim-Kervendonk gründet, „hat man mich als
den ausgeguckt, der eine Chronik für das Dorf erstellen soll“.
Bernhard Meiners gehört zu den Stillen im Dorf, die viel leisten und
trotzdem nicht im Mittelpunkt stehen. So bleibt der Rektor der
Kervenheimer Schule den Einwohnern in bester Erinnerung.
![]()