 |
 |
 |
  |

|
Schneller Brüter Kalkar
Entwickelt ab 1972
![]()
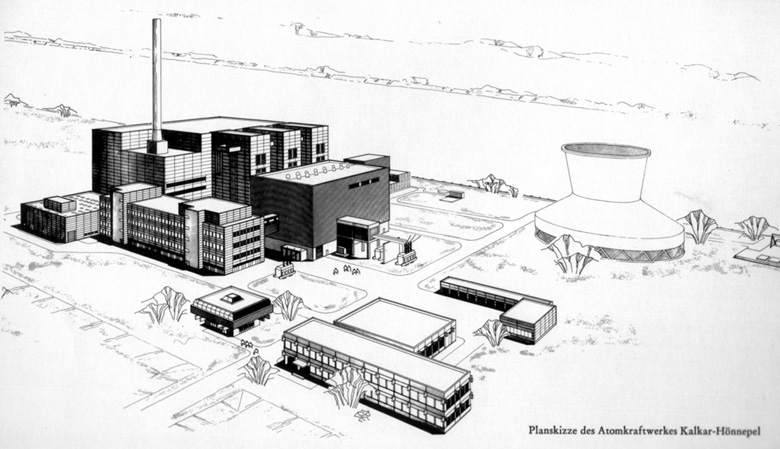
Planskizze des
Atomkraftwerks Kalkar-Hönnepel.
Was Hunderttausende Demonstranten in Kalkar über die Jahre nicht schafften, besorgte der
Super-GAU im fernen Tschernobyl: Der Schnelle Brüter starb, ehe er ans
Netz gehen konnte.
Im Januar 1972 begann das Großprojekt Kalkar mit der Gründung der
Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH in Essen. Sie hatte die
Aufgabe, in Kalkar den Prototyp eines natrium-gekühlten Schnellen
Brutreaktors zu errichten und zu betreiben.
Wer heute über das Gelände in Kalkar-Hönnepel schreitet, setzt seine
Füße mit Ehrfurcht: Er tritt auf dem teuersten Flachland der Republik
herum. Jeder Quadratmeter hat den Steuerzahler 25.000 DM gekostet.
Kalkar war mit über fünf Milliarden Mark die größte Einzelruine der
Republik.
Eigentlich hätte nichts schief laufen können: Die mächtigsten
Stromversorger Deutschlands, Belgiens und der Niederlande machten sich
im Schulterschluss ans Werk. Im Etat war gut eine Milliarde D-Mark
gebunkert: So viel sollte der Brüter kosten. Dass er fünf Mal so teuer
werden und nie ans Netz gehen würde, konnten sich die Manager damals
nicht einmal in ihren schlimmsten Albträumen vorstellen.
Im April 1973 erfolgte das, was man einen ersten Spatenstich nennt. In
19 Teilgenehmigungen und gegen massenhafte Demonstrationen wurde die
größte Einzelbaustelle in der Bundesrepublik scheibchenweise
vorangetrieben - fast 15 Jahre lang.
Bis sich im April 1986 Tschernobyl ereignete. Die Kernschmelze an der
Grenze zu Weißrussland beschleunigte den Erkenntnisprozess, dass der für
Kalkar geplante Brüter - von seinem fragwürdigen Nutzen abgesehen - in
Deutschland nicht einsetzbar war.
Im März 1991 stiegen Bundesregierung und Betreiber-Gesellschaften aus
dieser Technologie aus und hinterließen Knall auf Fall die teuerste und
jungfräulichste Wirtschaftsruine aller Zeiten: Der praktisch fertig
gestellte Brüter wurde stillgelegt, kurz bevor er zum ersten Mal
strahlen konnte.
Die Lokalpolitiker von Kalkar gingen auf die Palme: 400 Arbeitsplätze
weg und dazu noch eine Riesen-Hypothek mit dem schier unverkäuflichen
Klotz am Bein. Kalkars Bürgermeister Karl-Ludwig van Dornick jammerte
damals: „Wir fühlen uns vorn und hinten betrogen. Ein internationales
Unternehmen wie die RWE kann sich nicht so einfach fortstehlen.“ Und:
„Jetzt geht die Kiste zu Bruch, und wir sind Pleite.“
Der Bürgermeister sah Kalkar schon beteiligt an den befürchteten
Abrisskosten von rund 250 Millionen Mark.
Der Staat ließ die Region allerdings nicht hängen, sondern pumpte noch
einmal fast 140 Millionen DM in Projekte, um die Infrastruktur zwischen
Rhein und Niers aufzumöbeln.

Der berüchtigte Betonzaun
und Wassergraben zum Schutz des Schnellen Brüters in Kalkar vor den
Atomkraftgegnern, die gegen dass Kernkraftwerk demonstrierten.
Dann wurde die Ruine als Sonderangebot verscherbelt. Der seinerzeit
44-jährige Niederländer Henny van der Most bekam den Zuschlag für sein
„Kernwasserwunderland“, eine Freizeitanlage mit Hotels und Attraktionen.
Der Kaufvertrag wurde Anfang November 1995 unterzeichnet. Etwa drei
Millionen soll der Käufer hingeblättert haben - kaum mehr als 0,06
Prozent der Erstehungskosten.
Im April 1996 war von der Most endgültig Eigentümer des verhinderten
Schnellen Brüters von Kalkar.
![]()
![]()