 |
 |
 |
  |

|
Thälmann, Ernst
... und der Nachkriegsprozess gegen einen Lehrer in Geldern
![]()
 Die
Kevelaerer gaben bei der Reichspräsidentenwahl am 13. März 1932 die
meisten Stimmen dem amtierenden Präsidenten Hindenburg. 3.558 Kevelaerer
votierten für ihn, für Hitler sprachen sich nur 746 Kevelaerer aus.
Überraschend gut schnitt der Kommunistenführer Ernst Thälmann in der
Wallfahrtsstadt ab: 172 Kevelaerer wählten ihn und damit die KPD.
Die
Kevelaerer gaben bei der Reichspräsidentenwahl am 13. März 1932 die
meisten Stimmen dem amtierenden Präsidenten Hindenburg. 3.558 Kevelaerer
votierten für ihn, für Hitler sprachen sich nur 746 Kevelaerer aus.
Überraschend gut schnitt der Kommunistenführer Ernst Thälmann in der
Wallfahrtsstadt ab: 172 Kevelaerer wählten ihn und damit die KPD.
Ernst Thälmann (* 1886, † 1944) war von 1924 bis 1933 Mitglied des Reichstags der Weimarer Republik und von 1925 bis 1933 Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD).
Insgesamt
verfehlte Hindenburg knapp die absolute Mehrheit, so dass für den 24.
April ein zweiter Wahlgang im Deutschen Reich angesetzt wurde. In
Kevelaer lief es für Hindenburg auch diesmal hervorragend (3.547
Stimmen). Hitler verbesserte sich von 746 auf 866 Stimmen, und zwar
hauptsächlich auf Kosten von Thälmann, den nur noch 120 - statt 172 -
Kevelaerer wählten. Hindenburg blieb Reichspräsident. Hitler und
Thälmann hatten mit 36,8 bzw. 10,2 Prozent der Stimmen das Nachsehen.
Es dauerte nur ein Dreivierteljahr, bis alles in Deutschland
umgekrempelt war: Im Januar 1933 nahm mit der Ermächtigung des
Reichskanzlers Hitlers die deutsche Tragödie ihren Anfang. Kaum zwei
Monate im Amt, ließ Hitler den KPD-Führer Ernst Thälmann und viele
andere Oppositionelle verhaften. Thälmann, am 3. März 1933 in Berlin
festgesetzt, wurde des Hochverrats beschuldigt. Der Kommunistenführer
war zunächst im Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit eingeschlossen.
Hitler verfügte 1935, den vorbereiteten Prozess gegen Thälmann
einzustellen, weil "befürchtet" wurde, dass der Angeklagte höchstens mit
15 Jahren Freiheitsentzug bestraft werden würde. Thälmanns
Untersuchungshaft wurde in Schutzhaft umgewandelt, womit sich die Nazis
einen Freibrief für unbegrenzte Inhaftierung beschafften.
1939, nach Abschluss des Hitler-Stalin-Pakts, hoffte die Ehefrau
Thälmanns auf Hilfe durch Stalin und trug in der sowjetischen Botschaft
in Berlin eine entsprechende Bitte vor. Aber Stalin setzte sich nicht
für Gefangenen ein.
Ernst Thälmann wurde 1943 vom Gerichtsgefängnis Hannover in die
Haftanstalt Bautzen verlegt. Im Jahr darauf verhafteten die Nazis seine
Tochter Irma und Ehefrau Rosa und lieferten sie ins Konzentrationslager
Ravensbrück ein.
Am 14. August 1944 ordnete Hitler in seinem Hauptquartier "Wolfsschanze"
in Ostpreußen die Ermordung Ernst Thälmanns an. Drei Tage nach dem
Todesbefehl wurde Thälmann ins Konzentrationslager Buchenwald verbracht
und am 18. August erschossen. Seine Leiche wurde unverzüglich im
Krematorium verbrannt. Die Nazi-Propaganda log der Öffentlichkeit vor,
Thälmann wäre bei einem Bombenangriff am 24. August ums Leben gekommen.
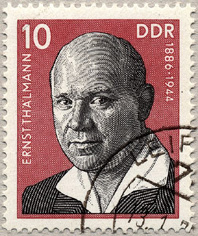 Dass
sein Name nicht in Vergessenheit geriet, dafür sorgte die Führung der
DDR, die Ernst Thälmann wie einen Heiligen verehrte und zum Sinnbild des
kommunistischen Widerstands aufbaute. Der Arbeiterführer war im Leben
der DDR-Bürger allgegenwärtig - kaum eine Stadt, die keine
Ernst-Thälmann-Straße besaß. Und Margot Honecker wusste ihre
Volksgenossen immer wieder zu belehren: "Ihr wisst, sein Leben war dem
Kampf um die höchsten Ideale der Menschheit gewidmet".
Dass
sein Name nicht in Vergessenheit geriet, dafür sorgte die Führung der
DDR, die Ernst Thälmann wie einen Heiligen verehrte und zum Sinnbild des
kommunistischen Widerstands aufbaute. Der Arbeiterführer war im Leben
der DDR-Bürger allgegenwärtig - kaum eine Stadt, die keine
Ernst-Thälmann-Straße besaß. Und Margot Honecker wusste ihre
Volksgenossen immer wieder zu belehren: "Ihr wisst, sein Leben war dem
Kampf um die höchsten Ideale der Menschheit gewidmet".
Die Mörder Thälmanns waren unbekannt, bis 1947 ein ehemaliger Häftling
des KZs Buchenwald in einem Radiobericht auf einen Wolfgang Otto
verwies. Seitdem galt Otto als Verdächtiger, ohne dass juristische
Schritte gegen ihn eingeleitet wurden. Erst nach einer Kampagne in der
DDR (1962) kam es in den folgenden 25 Jahren zu sieben
Ermittlungsverfahren gegen Otto - jedesmal erfolglos. Ein
Auslieferungsersuchen der DDR wurde abgelehnt.
Wolfgang Otto (* 1911 in Kattowitz, † 1989 in Geldern) war vor dem Krieg
Lehrer von Beruf. 1939 wurde er zur Waffen-SS einberufen und im KZ
Buchenwald eingesetzt. Als Angehöriger des SS-Totenkopf-Sturmbanns
Buchenwald übte er zunächst Wachaufgaben aus und wurde 1943 „Spieß“ der
Lagerkommandantur. Zugleich war er Leiter des Kommandos 99, des
Exekutionskommandos des Konzentrationslagers. Bei zahlreichen
Hinrichtungen war Wolfgang Otto anwesend. Ihm oblag es, die Exekutionen
zu terminieren, den reibungslosen Ablauf zu organisieren und die Spuren
zu verwischen.
Otto wurde nach der Befreiung vom NS-Regime durch die Alliierten verhaftet. Er gehörte zu den
30 Beschuldigten im Buchenwald-Prozess und wurde wegen Mithilfe und
Teilnahme an den Gewaltverbrechen im KZ Buchenwald zu 20 Jahren Haft
verurteilt, die später auf zehn Jahre Haft reduziert wurden. Otto, der
eine Beteiligung an der Ermordung des KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann
bis zuletzt abstritt, kam im März 1952 wegen guter Führung vorzeitig in
Freiheit.
Das Land Nordrhein-Westfalen stellte ihn 1954 als Lehrer ein. Otto
unterrichtete - auch im Fach Religion - in der katholischen Volksschule
Goch und ab 1959 in der katholischen Volksschule Geldern. Aus seiner
Vergangenheit machte er keinen Hehl, betonte jedoch, er sei im KZ
Buchenwald lediglich mit Schreib- und anderen Büroaufgaben beschäftigt
gewesen. Als Ottos tatsächliche Funktion in Buchenwald bekannt wurde,
wurde ihm Mitte 1962 mit sofortiger Wirkung die Lehrertätigkeit
untersagt. Trotzdem gelang es ihm, vor dem Verwaltungsgericht eine
lebenslange Pension (1.700 DM) zu erstreiten.
Unterdessen wurde siebenmal vergeblich versucht, Otto wegen seiner
(letztlich nicht bewiesenen) Mittäterschaft bei der Ermordung Thälmanns
den Prozess zu machen. Irma Gabel-Thälmann, die Tochter Thälmanns,
schaffte es 1982 über einen Klageerzwingungsantrag vor dem
Oberlandesgericht Köln, dass 1985 ein Hauptverfahren vor dem Landgericht
Krefeld gegen den in Geldern lebenden Lehrer eröffnet wurde. Das Urteil
(vier Jahre Haft wegen Beihilfe zum Mord) wurde vom Bundesgerichtshof
1987 aufgehoben.
Im August 1988, ein Jahr vor seinem Tod, wurde Otto vom Landgericht
Düsseldorf freigesprochen.
Freitag, 22. Februar 2013
![]()
![]()