 |
 |
 |
  |

|
Freimaurerei am Niederrhein
Einzige Loge im Kreis Kleve: Pax inimica malis zu Emmerich
![]()
Wir lieben
ihre Musik und schmücken Straßenschilder in Kevelaer mit ihren Namen:
Haydn, Beethoven, Lortzing, Mozart. Doch was sie außer Musik noch verbindet,
ist für manchen keine Musik in seinen Ohren: Sie waren
Freimaurer.
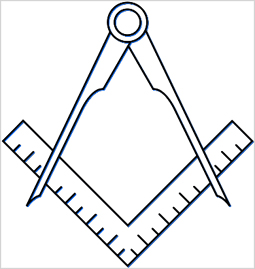 Der Dichter Adalbert von Chamisso († 1838), Maler Lovis Corinth (†
1925), Philosoph Johann Gottlieb Fichte († 1814), Preußenkönig Friedrich
(der Große), Dichter Johann Wolfgang von Goethe († 1832), Philosoph
Johann Gottfried Herder († 1803), Dichter Ephraim Lessing († 1781),
Komponist Franz von Liszt († 1886) - sie und etliche andere Deutsche mit
weltbekannten Namen gehörten dem Freimaurerbund an und waren deswegen,
falls sie der katholischen Kirche angehörten, zugleich exkommuniziert.
Der Dichter Adalbert von Chamisso († 1838), Maler Lovis Corinth (†
1925), Philosoph Johann Gottlieb Fichte († 1814), Preußenkönig Friedrich
(der Große), Dichter Johann Wolfgang von Goethe († 1832), Philosoph
Johann Gottfried Herder († 1803), Dichter Ephraim Lessing († 1781),
Komponist Franz von Liszt († 1886) - sie und etliche andere Deutsche mit
weltbekannten Namen gehörten dem Freimaurerbund an und waren deswegen,
falls sie der katholischen Kirche angehörten, zugleich exkommuniziert.
Zirkel und Winkelmaß: Zeichen der Freimaurer.
Was ist Freimaurerei? Was wollen Freimaurer?
Um sich gegen "Werksspionage", wie wir heute sagen würden, zu schützen,
ließen die Steinmetze und Baumeister des Mittelalters zu ihren
Versammlungen nur Leute zu, die sich als Mitglieder ihrer Zunft
ausweisen konnten, beispielsweise durch ein Paßwort. Der Geist in den
Dombauhütten gewann im Laufe der Zeit eigenständige, vom ursprünglichen
Handwerk unabhängige Bedeutung. Von den in den Zünften gepflegten
Idealen wie Menschlichkeit, Rechtschaffenheit oder Toleranz fühlten sich
auch Nicht-Steinmetze angezogen. So wandelte sich Anfang des 18.
Jahrhunderts die zunächst berufsbezogene, operative Freimaurerei zur
spekulativen Freimaurerei - zu einem humanitären Bund, dem "freie Männer
von gutem Ruf" beitreten konnten.
Um sich eine verfasste Ordnung zu geben, schrieb der britische
Geistliche Anderson 1723 die "Alten Pflichten" der Freimaurer nieder,
die bis heute das "Grundgesetz" in ihren Zirkeln, den Logen, sind. Es
sei ratsam, formulierte Anderson, Freimaurer "bloß zu der Religion zu
verpflichten, in welcher alle Menschen übereinstimmen, und jedem seine
besonderen Überzeugungen zu lassen; das heißt, sie sollen gute und
wahrhafte Männer sein, Männer von Ehre und Rechtschaffenheit, durch was
für Sekten oder Glaubensmeinungen sie sich auch sonst unterscheiden
mögen."
Nach den blutigen Verfolgungen des 16. und den heftigen Religionskriegen
des 17. Jahrhunderts wollten der Geistliche der Presbyterianischen
Kirche, James Anderson, und seine Freimaurerbrüder im höchsten Maße
tolerant sein und jedes Streitgespräch über religiöse Fragen aus den
Logen verbannen. "Das aber war nur möglich, wenn man den größten
gemeinsamen Nenner allen Glaubens, den Glauben an Gott als den ´Großen
Baumeister aller Welten` zur Grundlage der Freimaurerei machte, und
darüber hinaus jedem seine persönliche Überzeugung, seinen Glauben
ließ", erläutert Winfried Berkowicz (†) aus Kleve, Studiendirektor a.D.,
der über "Katholische Kirche und Freimaurerei" gearbeitet hat. (Aus
ähnlichen Gründen wie bei den Freimaurern sind beispielsweise auch bei
den Rotariern Streitgespräche über Politik oder Religion untersagt.)
 "Und wenn er seine Kunst recht versteht", schrieb Anderson über den
Freimaurer, "wird er weder ein dummer Gottesleugner (stupid atheist)
oder ein religionsloser Freigeist (irreligious libertine)
sein."
"Und wenn er seine Kunst recht versteht", schrieb Anderson über den
Freimaurer, "wird er weder ein dummer Gottesleugner (stupid atheist)
oder ein religionsloser Freigeist (irreligious libertine)
sein."
Das Bijou der Emmericher Loge "Pax inimica malis".
Das war und ist der Reibepunkt, um den es bei der Auseinandersetzung
zwischen den Kirchen und der Freimaurerei seit Jahrhunderten geht: Der
größte gemeinsame Nenner für einen Gottesbegriff ("Baumeister aller
Welten"), in dem sich der Christ ebenso wiederfinden kann wie der Jude
oder Moslem, erweckte bei den Kirchen den Verdacht, hier sei eine neue
Religion mit einem neuen Gottesbild gestiftet worden - indifferent und
unabhängig vom Gnadenerweis, den gerade die katholische Kirche kennt.
Das Missverständnis ist bis heute nicht ausgeräumt.
Bereits 15 Jahre nach Veröffentlichung der "Alten Pflichten" ging der
Vatikan auf Distanz: "Da wir die schweren Schäden erwägen, welche so oft
durch solche Gesellschaften oder Zusammenkünfte nicht nur der Ruhe des
Staates, sondern auch dem Heile der Seelen zugefügt werden … haben wir
für gut befunden und beschlossen, besagte Gesellschaften … zu
verurteilen und zu verbieten", verkündete der Papst und sprach die
Exkommunikation aus: "Verurteilung der Gesellschaft oder der heimlichen
Zusammenkünfte, gewöhnlich ´Liberi muratori` oder ´Francs macons`
genannt, unter Strafe der mit der Tat sofort eintretenden
Exkommunikation, von der die Lossprechung, die Sterbestunde ausgenommen,
dem Papst vorbehalten bleibt." (In eminenti, Bulle von Papst Clemens
XII., 28.4.1738)
Auch die Tugend des Schweigens über innere Angelegenheiten wurde den
Freimaurern zum Verhängnis: (Es wird angeführt, daß die Freimaurer)
"sich durch ein enges und geheimnisvolles Bündnis ... miteinander
verbinden und sowohl durch einen auf die Heilige Schrift abgelegten Eid
als auch durch Androhung schwerer Strafen zu einem unverbrüchlichen
Stillschweigen über das, was sie gleichfalls im geheimen wirken,
verpflichtet werden. (...) denn wenn sie nichts Böses täten, so würden
sie nicht so sehr das Licht hassen", heißt es in der
Verurteilungsschrift des Vatikan.
"Wer Mitglied der Freimaurerei oder einer anderen derartigen
Gesellschaft wird, die sich gegen die Kirche und die rechtmäßige
weltliche Obrigkeit verschwören, verfällt durch die Tat selbst einer
Exkommunikation, deren Aufhebung dem Hl. Stuhl vorbehalten ist",
bekräftigte 1751 Papst Benedikt XIV. im Codex iuris canonici (Kanon
2335), dem Kirchlichen Gesetzbuch.
In der Aufklärung nahmen es die Kleriker dann nicht mehr so genau mit
dem Freimaurerverbot. In der französischen Zisterzienser-Abtei Clairvaux
wurde 1786 aus dreizehn Mönchen eine Freimaurerloge gegründet. In den
meisten deutschen Logen arbeiteten katholische und evangelische
Geistliche mit. Und auch der Bischof von Münster, Max von
Droste-Vischering († 1846), wurde Freimaurerbruder. Freimaurerisches
Denken und katholischer Glauben, wusste man damals, widersprechen sich
nicht, weil sie nichts miteinander zu tun haben.
Dann kam Papst Leo XIII.: "Die Freimaurer lehren, daß alle Menschen
gleiche Rechte hätten und völlig gleich geboren würden; daß jeder Mensch
von Natur aus unabhängig sei … Deshalb sei das Volk souverän, und die es
regierten, hätten nicht mehr obrigkeitliche Gewalt, als ihnen das Volk
anvertraue." (Enzyklika Humanum genus, 1884)
Was heute zu den selbstverständlichen Menschenrechten gehört, war 1884
ein Sakrileg, das mit der Exkommunikation bestraft wurde.
Die Freimaurer hofften, dass sich wenigstens nach dem 2. Vatikanischen
Konzil das Verhältnis der Kirche zu ihrem Bund entkrampfen würde. Gute
Nachrichten aus Rom:
"Wir können aber Gott, den Vater aller, nicht anrufen, wenn wir irgendwelchen Menschen, die ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, die brüderliche Haltung verweigern. Das Verhalten des Menschen zu Gott dem Vater und sein Verhalten zu den Menschenbrüdern stehen in so engem Zusammenhang, daß die Schrift sagt: ´Wer nicht liebt, kennt Gott nicht` (1 Jo 4,8). (…) Deshalb verwirft die Kirche jede Diskriminierung eines Menschen oder jeden Gewaltakt gegen ihn um seiner Rasse oder Farbe, seines Standes oder seiner Religion willen, weil dies dem Geist Christi widerspricht."(Vaticanum II, Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, Art. 5, 28.10.1965)
Die Worte
machten Hoffnung, und Logenmitglieder aus Emmerich, praktizierende
Katholiken, schrieben an den Bischof von Münster.
"Bislang ist Canon 2335 CIC nicht aufgegeben", lasen sie in der Antwort.
"Wir rechnen damit, dass in absehbarer Zeit ein Rundschreiben der
Glaubenskongregation zu dem von Ihnen angesprochenen Thema erscheinen
wird. Anerkannte kirchenrechtliche Fachleute sind bereits seit längerer
Zeit der Meinung, der Canon 2335 sei so zu interpretieren, daß Verbot
und Sanktion nur dann gelten, wenn die im Canon genannten
Voraussetzungen zutreffen, d.h., wenn die betreffende Freimaurerloge
tatsächlich kirchenfeindlich eingestellt ist." (Bischöfliches
Generalvikariat Münster, 13.5.1974)
Und weitere hochkarätige Aussagen stimmten erwartungsfroh: "Bei der
Behandlung der einzelnen Fälle muß man sich gegenwärtig halten, daß das
Strafgesetz im strikten Sinn zu interpretieren ist. Deshalb kann mit
Sicherheit die Ansicht jener Autoren (…) auch praktisch zur Anwendung
gebracht werden, die der Meinung sind, daß Kanon 2335 nur diejenigen
katholischen Mitglieder jener Freimaurer-Logen trifft, die in Tat und
Wahrheit gegen die Kirche agitieren". (Kardinal Seper für die
Glaubenskongregation, Rechtsbelehrung für die Bischöfe, 18.7.1974)
Schließlich verbreitete Radio Vatikan 1980 ein Interview: "Frage: Don
Esposito, aber was ist mit den historischen Bannflüchen, welche von
Seiten der Kirche gegen die Freimaurer geschleudert wurden? Sind sie
noch in Kraft oder sind sie zurückgenommen? Antwort: Sie sind
zurückgenommen. In der Tat gibt es den berühmten Brief von Kardinal
Seper, dem Präfekten der Kongregation für den Glauben, an Kardinal Krol,
den Präsidenten der Amerikanischen Bischofskonferenz. … Dieses Dokument
setzt einen Schlußstrich unter die bisherigen Probleme." (Radio Vatikan,
Interview mit dem Historiker und Priester Don Rosario F. Esposito,
Januar 1980)
Im selben Jahr ging ein sechsjähriges Gespräch zwischen der
Bischofskonferenz und der Großloge von Deutschland zu Ende. Die
Freimaurer rechneten nach den vielen Signalen fest mit einem für sie
positiven Ergebnis. Für sie völlig überraschend gab die
Bischofskonferenz im Mai 1980 eine Presseerklärung heraus, die in dem
Ergebnis gipfelte:
"Eingehende Untersuchungen der freimaurerischen Ritualien und Grundüberlegungen wie auch ihres heutigen unveränderten Selbstverständnisses machen deutlich: Die gleichzeitige Zugehörigkeit zur katholischen Kirche und zur Freimaurerei ist unvereinbar." (Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz, 5/1980)
Noch nie hat ein Papst wirklich revidiert, was einer seiner Vorgänger verkündet hatte. Ein halbes Dutzend Päpste hätte Johannes Paul II. korrigieren müssen. Rom hatte in die deutschen "Verhandlungen" eingriffen und gab ein Jahr später selbst bekannt:
"Am 19. Juli 1974 schrieb
diese Kongregation an einige Bischofskonferenzen einen Brief über die
Interpretation des can. 2335 des Codex Iuris Canonici, der den
Katholiken unter Strafe der Exkommunikation verbietet, sich bei
freimaurerischen oder ähnlichen Vereinigungen einzuschreiben. Nachdem
dieser Brief in der Öffentlichkeit Anlaß zu falschen und tendenziösen
Interpretationen gegeben hat, bestimmt und erklärt diese Kongregation
wie folgt. Dabei will sie in keiner Weise eventuellen Bestimmungen des
neuen Kodex vorgreifen:
1. Die gegenwärtige kanonische Vorschrift ist in
keiner Weise geändert worden und bleibt voll in Kraft.
2. Es sind also
weder die Exkommunikation noch die anderen Strafen abgeschafft worden.
3. Soweit es in dem erwähnten Brief um Interpretationen geht, wie der
entsprechende Kanon im Sinn der Kongregation zu verstehen sei, handelt
es sich nur um einen Verweis auf die allgemeinen Prinzipien der
Interpretation von Strafgesetzen zur Lösung persönlicher Einzelfälle,
die dem Urteil des Ortsordinarius überlassen werden können.
Es war
jedoch nicht Absicht dieser Kongregation, den Bischofskonferenzen das
Recht zu geben, öffentlich ein allgemeines Urteil über die Natur der
Freimaurerei abzugeben, welches eine Abschaffung der erwähnten Norm
beinhalten würde." (Glaubenskongregation, 11.2.1981 - Übersetzung)
Kardinal Ratzinger legte die mit ausdrücklicher Zustimmung des Papstes
veröffentlichte Erklärung nach: Die Freimaurerei bleibe "unvereinbar mit
der Lehre der Kirche. Katholiken, die Freimaurer sind, machen sich einer
schweren Sünde schuldig und haben keinen Zugang zur Kommunion."
(Kardinal Ratzinger, Präfekt der Glaubenskongregation, 1983)
Als ein Klever Freimaurer 1989 bei seinem Bischof den damals aktuellen Stand
erfragte, bekam er die Antwort: "Die von Ihnen erbetene kurze und klare
Antwort heißt ´Ja`, die zitierte Aussage der Deutschen Bischofskonferenz
hat weiterhin Gültigkeit." (Reinhardt, Bischöfliches Generalvikariat, an
Winfried Berkowicz, Kleve, Dezember 1989)
Die ebenso klare wie harte Ablehnung der katholischen Kirche gegenüber
der Freimaurerei, an der sich substanziell bis heute nichts geändert
hat, wird immer unverständlicher, je mehr man in die "Geheimnisse der
Freimaurerei" eindringt.
"Sinn und Zweck der Freimaurerei ist es, dem
Menschen (...) einen Weg geistiger und sittlicher Fortbildung
aufzuweisen", heißt es in einer internen Schrift des Bundes.
Dabei beschränkt sich die Freimaurerei unmissverständlich auf das
Diesseits und gibt keine Antworten auf "letzte Fragen". Sie ist keine
religiöse Glaubensgemeinschaft, sondern kümmert sich - wie Rotarier oder
Lions - ausschließlich um das menschliche Zusammenleben hier und heute
auf der Erde.
Die Toleranz, eine ihrer wichtigsten Tugenden, die in den
Gruppen - Logen genannt - gelebt wird, lässt jedem Mitglied die
selbstverständliche Freiheit seines religiösen Bekenntnisses. Kein
Freimaurer fühlt sich, wenn er Christ, Jude oder Moslem ist, in
seiner Religionsausübung beeinflusst, eingeengt oder gar behindert. Wie
könnte es auch, da die Freimaurerei mit Religion nichts zu tun hat!
Aber das Missverständnis zwischen Freimaurerei und katholischer Kirche
ist schier unausrottbar:
Die Freimaurer sagen, der Begriff vom "Großen
Baumeister" ist ein Sinnbild für den göttlichen Schöpfergeist, und
schließen darin ausdrücklich jede Vorstellung ein, die der Gläubige als
seine Glaubenswahrheit erkennt, also auch den personalen Schöpfergott,
den die Gläubigen in den christlichen Kirchen anrufen.
Die katholische Kirche hält entgegen: Indem sich die Freimaurer nicht
festlegen und alle Gottes-Vorstellungen in ihrem Sinnbild vereinen,
hängen sie dem Indifferentismus an und prägen ein Gottesbild, das so
oder so aussehen kann.
Die katholische Kirche akzeptiert also nicht,
dass Freimaurerei ein auf das Diesseits gerichteter ethischer Bund ist,
sondern unterstellt ihr, religiöse Glaubensaussagen zu machen, nämlich
die von einem verwaschenen Gottesbild, das mit dem der katholischen
Kirche nichts zu tun habe.
Unter diesem elementaren Missverständnis leiden alle Freimaurer, die
praktizierende Katholiken sind oder es sein wollen. Sie wissen, dass ihr
Katholisch-Sein nicht im Widerspruch zu ihrer Mitgliedschaft in der Loge
steht - im Gegenteil: Oft machen sie die Erfahrung, dass sie über das
Logenleben und die geistige Erfrischung, die sie hier erleben, neuen und
intensiveren Anschluss an das Leben in der Kirchengemeinde finden.
Wer sich vergegenwärtigt, was Freimaurer in ihren Logen tun und wozu
sich ein Neumitglied ("Lehrling") verpflichtet, versteht nun gar nicht
mehr, warum die Kirche der Freimaurerei unversöhnlich gegenübersteht.
Der Freimaurer widmet sich, so verspricht er bei seiner Aufnahme, aus
vollem Herzen und mit ganzer Kraft der Humanität. Und er verhält sich
pflichtbewusst gegenüber seiner Familie, seiner Heimatgemeinde, seinem
Land und der Gemeinschaft aller Menschen. Die übrigen Verpflichtungen,
die er sich auferlegt, beziehen sich auf gute Tugenden wie Verschwiegenheit über
das, was ihm anvertraut worden ist, und Zuverlässigkeit und
Hilfsbereitschaft gegenüber seinen Mitbrüdern.
Das üben die Logenmitglieder bei ihren geselligen und rituellen
Zusammenkünften ein. Sie bauen, so das von ihnen benutzte Bild, "an dem
Tempel der Humanität", dessen "Steine" die einzelnen Menschen sind,
verbunden durch "Mörtel", der die Menschen miteinander verbindet:
Menschenliebe, Toleranz und Brüderlichkeit.
Im katholischen Kevelaer hat es nie eine Freimaurerloge gegeben. Die
einzige Loge im heutigen Kreis Kleve ist "Pax inimica malis" in
Emmerich. Weitere niederrheinische Logen arbeiten beispielsweise in Wesel, Duisburg
und Krefeld. "Pax inimica malis" ist mit Gründungsdatum 9.12.1779 der
älteste Verein in der Stadt Emmerich am Rhein. Er existierte
ununterbrochen bis zum Jahr 1935, in dem am 17. August die Freimaurerei
und ihre Logen von den Nazis im ganzen Dritten Reich verboten wurden.
 Nach
dem vernichtenden Schlag gegen die Freimaurer in der NS-Zeit - sämtliche
Immobilien und Besitz waren vernichtet oder enteignet worden - dauerte
es nach der Befreiung auch am Niederrhein lange, bis sich die Logen
wiederbelebten.
Nach
dem vernichtenden Schlag gegen die Freimaurer in der NS-Zeit - sämtliche
Immobilien und Besitz waren vernichtet oder enteignet worden - dauerte
es nach der Befreiung auch am Niederrhein lange, bis sich die Logen
wiederbelebten.
In der "Societät" in Emmerich ist in einem Kellergewölbe dieser Tempel der Freimaurerloge "Pax inimica malis" eingerichtet. Fotos: > pim.emmerich.freimaurerei.de
In Emmerich
zog ab 1945 fast ein Vierteljahrhundert ins Land, bis sich 1969 drei
Freimaurerbrüder aus der Vorkriegszeit und neun Brüder aus der
Duisburger Loge "Zur deutschen Burg" zusammenfanden, um der alten Loge
"Pax inimica malis" zu einem zweiten Leben zu verhelfen. Diese
Wiederbelebung gelang zum 25. Mai 1970.
Ob das Brauchtum der Freimaurer noch zeitgemäß ist, lässt sich genau so
leicht oder schwer beantworten wie die Frage, was "Ritterorden" und die
Träger wehender Mäntel uns heute zu sagen haben oder welche
Anziehungskraft Schützenbruderschaften in der Gesellschaft ausüben.
Die
geistige Idee der Freimaurerei, Menschlichkeit in diese Welt tragen
zu wollen, entzieht sich solchen Sinnfragen. Die Idee einer besseren Welt ist
so zeitlos wie das Menschsein selbst.
| Freimaurer Textstellen in der Kevelaerer Enzyklopädie: |
| | Königliche Besuche | Johannes Maria Verweyen | |
![]()
![]()