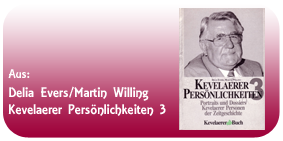|
 |
 |
  |

|
Kleuren-Schryvers, Dr. Elke
Initiatorin der Afrika-Hilfe Aktion pro Humanität | * 1959
![]()
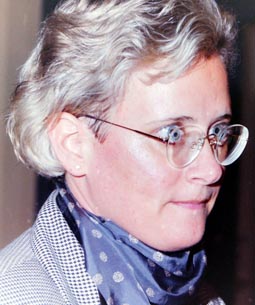 Die
kleine Elke Kleuren wächst in den 1960er-Jahren in Kellen als Einzelkind
auf und geht dort zur Schule. Ihr Elternhaus ist ausgesprochen gläubig
und fördert Elkes Sozialverantwortung von Kindesbeinen an. Gleichzeitig
behüten, sichern und schützen ihre Eltern das Mädchen und die junge
Frau, und sogar als später die fast 30-jährige Ärztin mit ihrem
Benin-Projekt beginnt, das sie am ganzen Niederrhein bekannt machen
wird, zeigen die Eltern ihre liebevolle Besorgnis um die Tochter.
Die
kleine Elke Kleuren wächst in den 1960er-Jahren in Kellen als Einzelkind
auf und geht dort zur Schule. Ihr Elternhaus ist ausgesprochen gläubig
und fördert Elkes Sozialverantwortung von Kindesbeinen an. Gleichzeitig
behüten, sichern und schützen ihre Eltern das Mädchen und die junge
Frau, und sogar als später die fast 30-jährige Ärztin mit ihrem
Benin-Projekt beginnt, das sie am ganzen Niederrhein bekannt machen
wird, zeigen die Eltern ihre liebevolle Besorgnis um die Tochter.
1978 macht Elke ihr Abitur und studiert Medizin in Düsseldorf. Nach dem
vorgeschriebenen praktischen Jahr in Krankenhäusern in Duisburg und
Kleve bildet sie sich bei niedergelassenen Ärzten im internistischen und
chirurgischen Bereich weiter. „Das war eine tolle Zeit“, sagt sie
später.
Elke Kleuren, die angehende Ärztin, und die Menschen im Dorf Kervenheim,
wo sie später praktizieren wird, wissen noch nichts voneinander. Seit
den 1970er-Jahren kämpfen die Kervenheimer um die Niederlassung eines
Arztes - lange Zeit ohne Erfolg. Als sich hier 1981 der seit 15 Jahren
in der Bundesrepublik lebende indonesische Mediziner Dr. Sunbien Ho als
praktischer Arzt niederlassen will, scheitert das am Formalismus: Der
Mann, am Rheinberger Krankenhaus als Gynäkologe beschäftigt, ist 15
Monate jünger als das vorgeschriebene Mindestalter von 35. Erst dann
darf er eingebürgert werden. Aber ohne Einbürgerung ist er darauf
angewiesen, dass der Regierungspräsident einer Zulassung zum frei
praktizierenden Arzt zustimmt. Und das tut er nicht: „... aus
entwicklungspolitischen Gründen“.
Die Kevelaerer Ratsfraktionen schalten sich auf Anregung von
Ortsvorsteher
> Theo
Kothes mit einer Resolution an den Regierungspräsidenten ein: „Der
Rat befürwortet die Bewerbung des Herrn Dr. Sunbien Ho und begrüßt
dessen Bereitschaft, sich in Kervenheim als praktischer Arzt
niederzulassen“. Dringend wird an die zuständigen Landesminister und vor
allem an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf appelliert, das
Einbürgerungsgesuch und das Approbationsverfahren für Dr. Ho
beschleunigt zu erledigen und positiv zu bescheiden - vergebens.
Sieben Jahre später kommt den Kervenheimern ein Zufall zu Hilfe. Dr.
med. Elke Kleuren ist 29 Jahre alt, als sie beschließt, sich als
Allgemeinärztin niederzulassen und eine eigene Praxis zu betreiben. Ihre
Wahl fällt auf den „weißen Fleck“ im Kreis Kleve, auf Kervenheim.
Während sich ihre neue Arztpraxis entwickelt, lässt sich Elke Kleuren,
die den Gocher Unternehmer Herbert Schryvers heiratet, von der
unvorstellbaren Not in Afrika anrühren. Grauenhafte Bilder aus Somalia
gehen um die Welt. Sie lassen die junge Ärztin nicht mehr los. Schon
während des Medizinstudiums hat sie mit dem Gedanken gespielt, für ein
Krankenhauspraktikum in die südafrikanischen Homelands zu gehen, wo die
armen Farbigen leben. Doch das hat sich zerschlagen.
Elke Kleuren-Schryvers bekommt auf dem Höhepunkt der Somalia-Katastrophe
Kontakt zu Christel und Rupert Neudeck von Cap Anamur. Sie engagiert
sich im Komitee Cap Anamur, das Soforthilfe für Somalia leisten will.
Die Kervenheimerin trommelt, unterstützt von ihrem Mann, Spenden
zusammen und kann im Herbst 1992 Dr. Christel Neudeck vom Komitee Cap
Anamur 50.000 Mark überreichen.

Herbert Schryvers und seine
Frau Elke mit Gästen aus Afrika.
Auf Initiative von Herbert Schryvers,
der auch mit Einbauküchen handelt, legt eine Vereinigung von
Küchenhändlern noch 25.000 Mark drauf. Zum Abschluss der erfolgreichen
Aktion, der ersten von Elke Kleuren-Schryvers, wird im
>
Kevelaerer
Bühnenhaus ein Benefizkonzert gegeben, bei dem nicht nur Elke
Kleuren-Schryvers und Christel Neudeck strahlen: Volles Haus und tolles
Programm. Insgesamt bringt die Initiative der Kervenheimerin über
110.000 Mark für Somalia zusammen.
Mit dieser Nothilfe für Somalia wird in der Kervenheimer Ärztin das
Bedürfnis geweckt, etwas Grundsätzliches und Dauerhaftes für arme
Menschen in Afrika zu leisten. Den letzten Anstoß bekommt sie beim Lesen
eines Spiegel-Berichts über Benin. Ihr ist klar, dass auch in ihrem
Heimatland nicht alles zum Besten steht, aber in Afrika geht es um die
nackte Existenz - um Leben oder Tod. „In Deutschland verhungert niemand!
In Afrika habe ich Menschen verhungern sehen. Das geht tief. Das
vergisst man nicht“, sagt die Ärztin.
Noch unter der Flagge von Cap Anamur, das eigentlich auf Sofortmaßnahmen
im Katastrophenfall spezialisiert ist, nimmt sie 1993 das
westafrikanische Land Benin in den Blick. Es ist eines der ärmsten
Länder dieser Erde. Dort will die Ärztin eine Krankenstation aufbauen -
ein abenteuerlicher Gedanke, der fern jeder Realität zu sein scheint,
denn wie soll von Kervenheim aus - Elke Kleuren-Schryvers will ja ihre
Zelte in Kervenheim nicht abbrechen - eine Station im Busch von Benin
organisiert werden? Und woher soll das viele Geld kommen?
Bekannte von Elke Kleuren-Schryvers, die von ihren Plänen erfahren,
fassen sich an den Kopf. Dort in Afrika verhungern Hunderttausende, was
kann die Kervenheimerin da bewirken, was mehr als ein Tropfen auf den
heißen Stein ist? „Mir haben Freunde gesagt, du kannst die Welt nicht
verbessern. Nein, das kann ich wirklich nicht. Aber ich kann versuchen,
in einem kleinen Umfeld etwas zu erreichen und dafür mein Bestes zu
geben.“
Die Ärztin rührt wie ein Profi die Werbetrommel am unteren Niederrhein.
Die Menschen lassen sich von dem Elan anstecken und spenden, bis im
Herbst 1993 rund 300.000 Mark auf dem Konto liegen. Elke und ihr Mann
Herbert fliegen nach Benin und legen sich fest: In der Ortschaft Gohomè
soll die Krankenstation aufgebaut werden. Sie soll die medizinische
Basisversorgung für rund 20.000 Menschen sicherstellen.
Die deutsche Öffentlichkeit erfährt nicht viel davon, wieviel Arbeit das
Ehepaar in die Entstehungsphase investieren muss. Ende März 1995 steht
der Rohbau. Zeitgleich werden Einrichtungsgegenstände, Medikamente und
ein vom Kevelaerer Opel-Händler Josef Maassen gestifteter und besonders
ausgestatteter Geländewagen verschifft. Elke Kleuren-Schryvers kann die
Benin-erfahrene Kinderkrankenschwester Anne Bauer gewinnen; die
Fachkraft erhält für ihren Einsatz vor Ort einen Arbeitsvertrag für
sechs Monate.
Aus einem behütenden Elternhaus kommend, legt Elke Kleuren-Schryvers
zunehmend eigene Ängste ab. Sie steht zusammen mit ihrem Mann bei
Benin-Aufenthalten auch gefährliche Situationen durch, zum Beispiel bei
Straßensperren. Einmal werden ihnen Maschinenpistolen unter die Nase
gehalten, weil jemand aus der deutschen Gruppe aus Versehen einen
Soldaten fotografiert hat. Ihr Mann Herbert, als Unternehmer
risikobewusst und flexibel, verhilft ihr zu mehr Sicherheit im
Auftreten. „Wir haben alle Reisen nach Benin gemeinsam gemacht und uns
gegenseitig geschützt und gestützt. Ich wurde agiler, beweglicher,
selbstständiger, selbstsicherer“, sagt sie später in einem KB-Gespräch.
Derweil „klappert“ die Ärztin aus Leidenschaft in ihrer Heimat
unermüdlich für ihre Vision. Sie organisiert für April 1995 ein
Afrika-Forum in Kevelaer („Gerechtere Weltordnung im neuen
Jahrtausend?“) und hält die Sensibilität der Öffentlichkeit für ihr
Anliegen wach. Im September schickt sie an zahlreiche Empfänger einen
Brief:
Die Cap Anamur-Krankenstation in Benin wird in diesen Tagen fertiggestellt; das Centre Medical Gohomè wird jetzt seine Arbeit aufnehmen! In wenigen Tagen werden wir selbst wieder nach Benin fliegen, um in Gohomè alles in Augenschein zu nehmen und sicher noch bei vielen Dingen Hand mit anzulegen und vor allem noch viele organisatorische Probleme zu lösen. (...) Anne Bauer, unsere starke und unermüdliche Projektfrau vor Ort, der beninische Arzt Dr. Houiley und das gesamte beninische Team stehen unmittelbar vor der Aufnahme ihrer medizinischen Arbeit in Gohomè.
Elke Kleuren-Schryvers bietet in dem Brief kostbare Kunstdrucke zum Kauf an, außerdem - mit gleichen Motiven - Weihnachts-/Neujahrs-Briefkarten - alles „Bausteine“ für Benin. Die Fotografien der Drucke und Karten stammen von Harlan Ross Feltus, dem Vater von Barbara Becker und Schwiegervater von Boris Becker. Und dann beginnt die Krankenstation tatsächlich zu arbeiten! Am 18. September 1995 versorgt sie die ersten Patienten. Die Ärztin schreibt nach ihrer Rückkehr aus Benin:
Als wir morgens in Gohomè an der Krankenstation eintrafen, trauten wir unseren Augen kaum. Auf dem noch gar nicht bearbeiteten Außengelände der Krankenstation tummelten sich seit 7 Uhr in der Frühe mehrere hundert Menschen, vornehmlich Frauen mit ihren Kindern.
Es ist ein tief
berührender Augenblick, als Elke und ihr Mann, nun schon zum achten Mal
in Benin, mit eigenen Augen sehen, wie sehr ihre Krankenstation
gebraucht und von der einheimischen Bevölkerung angenommen wird.
Unser beninisch-deutsches Team, bestehend aus zwei Ärzten sowie
Krankenschwestern und -pflegern, schaffte an diesem ersten Tag ohne
Pause.
Bis zum 1. Oktober 1995 behandelt das beninische Team unter Leitung von
Anne Bauer ambulant. Das Team der Krankenstation - vom Pförtner und
Wächter über Putzfrauen, Techniker, Krankenpfleger und Hebamme bis zum
Arzt - ist komplett. Der operative beziehungsweise stationäre Betrieb
wird 1996 aufgenommen. Dann erst ist auch die Wasser- und
Stromversorgung gesichert; bis dahin rattert der hauseigene
Stromgenerator. Fünf junge Männer, kurzfristig eingestellt, graben einen
Wasserbrunnen.
Die Krankenstation will mit ambulanter Behandlung einen Bereich
abdecken, in dem etwa 20.000 Menschen in einem Umkreis von etwa zehn
Kilometern leben. Für stationäre und operative Behandlung - ab 1996 -
umfasst das Versorgungsgebiet sogar 70.000 Menschen. Die Kervenheimer
Ärztin gesteht später in einem Brief ein, dass sie die hervorragenden
Leistungen des Beniner Teams so nicht erwartet habe. „Sicher war dies
ein unbewusstes Vorurteil von mir“. Um so glücklicher ist sie darüber,
wie professionell in der Station gearbeitet wird.
Anfang 1996 wird auch mit dem Bau von zwei dreiklassigen Schulen in
Gohomè und Adjintime begonnen. Direkt neben der Krankenstation wird
später auch ein Waisenhaus errichtet. Dafür hat die Gemeinde Gohomè
bereits ein großes Grundstück in der Nachbarschaft der Krankenstation
zur Verfügung gestellt. Das Waisenhaus soll zunächst etwa 20 Kinder
aufnehmen.
Die Menschen in der Heimat von Elke Kleuren-Schryvers nehmen nach wie
vor herzlichen Anteil an den Projekten. Zur Kirmes in Winnekendonk - im
Juni 1996 - inszeniert der
>
Heimatverein Ons Derp im Zelt auf
dem neuen Markt ein Konzert mit Imitatoren bekannter Schlagersänger,
gesponsert von örtlichen Unternehmen. Jede Eintrittskarte nimmt an einer
Verlosung teil, bei der es Reisen zu gewinnen gibt - ebenfalls von
Kevelaerer Firmen gestiftet.
Die Hilfsbereitschaft - hier der Winnekendonker - ist keine
Einbahnstraße. Als Herbert Schryvers im August 1996 im Kevelaerer Blatt
liest, dass
>
Sophie Willems händeringend um Geldspenden bittet, weil sie sonst
den Transport von Rollstuhlfahrern aus dem Kreis Kleve für das jährliche
Blumenfest der Kranken und Behinderten in Winnekendonk nicht bezahlen
kann, übernimmt der Geschäftsmann die Beförderung der Rollstuhlfahrer
auf seine Kosten.
Zur Konzeption von Elke und Herbert Schryvers gehört der Plan, dass sich
die Krankenstation bald selbst tragen soll. Deshalb werden die
ärztlichen Leistungen nicht kostenlos erbracht. Eine stationäre
Unterbringung, egal wie lang sie dauert, kostet für Kinder umgerechnet 3
Mark, für Erwachsene 4,50 Mark. Die ambulante Konsultation eines
Krankenpflegers muss mit dem Gegenwert von 30 Pfennig bezahlt werden,
der Projektarzt kostet 90 Pfennig je Konsultation. Für eine
wiederkehrende Wundbehandlung oder einen öfter notwendig werdenden
Verbandswechsel werden umgerechnet 15 Pfennig verlangt.
Und weiter schlagen die Busch- und Werbetrommeln: Ende August 1997
richten Elke Kleuren-Schryvers und Benin-Freunde das erste
Afrika-Festival am Niederrhein auf dem
>
Kalkarer Ex-Brütergelände (>
„Kernwasser-Wunderland“) aus. Vieles, was
Afrika musikalisch, folkloristisch oder lukullisch „drauf hat“, wird in
Kalkar aufgefahren. Was unterm Strich erlöst wird, dient dem
Krankenhausprojekt.

Im Januar 1998
wurde der
Kervenheimer Ärztin im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses Kevelaer der
ihr verliehene Kaslkarer Ochsenorden überreicht. Rechts neben Dr. Elke
Kleuren-Schryvers: ihr Mann Herbert Schryvers (†).
Das unermüdliche Engagement der Kervenheimerin bleibt auch in ihrer
Heimat nicht ohne Folgen. 1998 wird der Ärztin der Kalkarer Ochsenorden
verliehen. Nach
>
Änne Kasper (1989) trägt zum zweiten Mal eine Kevelaererin diese
besondere Ehrung für mitmenschliches Engagement. Den Einheimischen, die
sie auszeichnen, erzählt Elke Kleuren-Schryvers bei einer kleinen Feier
im Kevelaerer Rathaus von den Menschen in Benin, von denen kaum jemand
älter als 50 Jahre wird. Dort ist es ein Glücksfall für Eltern, wenn ihr
Kind seinen fünften Geburtstag feiern kann. Stirbt eine Mutter, werden
die Kinder häufig ausgesetzt, weil kein Geld vorhanden ist, um
Babynahrung zu kaufen.
Kevelaers Bürgermeister
>
Dr. Friedrich Börgers („Sie haben so unglaublich viel getan“) und
Kalkars Bürgermeister Karl-Ludwig van Dornick („Ich bin beeindruckt von
der Vehemenz, Beharrlichkeit und von dem Enthusiasmus“) danken der
Ärztin. Später erzählt Elke Kleuren-Schryvers die bewegende Geschichte
des kleinen Marcelin. Als der Halbwaise in die Krankenstation von Benin
gebracht wird - Elke Kleuren-Schryvers und ihr Mann sind gerade da -,
wiegt der Junge, sechs Monate alt, 2500 Gramm. Seine Pflegemutter, die
ihn nicht stillen kann, ist mit ihm kilometerweit durch die Sonne bis zu
der Station gelaufen. Fast tot und völlig ausgetrocknet versucht der
Junge, die Hände an die Brust geklammert, ihr einen Tropfen
abzugewinnen. Marcelin wird sofort in die Krankenstation aufgenommen.
Nach geraumer Zeit wiegt er annähernd fünf Kilogramm, und sein
gesundheitlicher Zustand stabilisiert sich nach vielen Krisen.
Elke Kleuren-Schryvers entwickelt sich weiter, indem sie die krassen
Gegensätze in Afrika und in Deutschland erlebt. In Benin praktiziert der
Arzt Überlebens-Medizin, hier ist Elke Kleuren-Schryvers als
Kassenärztin in eine Wohlfahrtsmedizin eingebunden. „In Benin käme
niemand auf die Idee, wegen einer Bagatellgeschichte einen Arzt
aufzusuchen. Dort verlassen sich die Menschen auf bewährte Hausmittel
und ihre Selbstheilungskräfte. Um es krass zu sagen: Hier habe ich in
meiner Praxis schon eine Mutter gesehen, die kam, weil ihr Kind drei
Mückenstiche hatte. Wir müssen aufhören zu jammern.“

Dr. Elke Kleuren-Schryvers
in Kevelaer mit Gästen und Bürgermeister Dr. Friedrich Börgers (1994).
Ihr Engagement für Benin wirkt sich tief auf ihr Privatleben aus.
„Möchten Sie Kinder haben?“ wird sie 1998 in einem KB-Gespräch gefragt -
da ist die Ärztin 38 Jahre alt. „Das war eine wichtige Frage für meinen
Mann und mich“, antwortet sie. „Aber alles zusammen geht nicht. Der
Spannungskonflikt zwischen den Anforderungen wäre zu groß gewesen. Ein
Kind hätte darunter gelitten. Wir haben auch daran gedacht, ein
afrikanisches Kind zu adoptieren. Aber das hätte die Situation
verschärft, weil ein solches Kind noch mehr Aufmerksamkeit gebraucht
hätte.“
Es sind die Kinder, die es ihr besonders angetan haben. Als Elke
Kleuren-Schryvers bei ihrem vierten oder fünften Besuch Benins die
nähere Umgebung ihrer Krankenstation in Gohomè erkundet und mit einem
Wagen in den Busch fährt, kommt sie nach etwa 15 Kilometern Fahrt über
eine „Wellblechpiste“ in Ayoumi an, wo ein Waisenhaus steht. Sie sieht
einen kleinen traurigen und trostlosen Haufen von Mädchen und Jungen.
Zwei Kinder sind dem Verhungern nahe, auch die anderen befinden sich in
einem erbarmungswürdigen Zustand.
Noch am selben Tag fährt die Ärztin in die beninische Hauptstadt Cotonou
zu einem befreundeten Afrikaner, der beim Aufbau der Krankenstation
unersätzlich gewesen ist. Sie berichtet ihm schockiert von ihren
Erlebnissen. Akin Fatoyinbo will sie beruhigen: In Benin gebe es
unterernährte und mangelernährte Kinder, aber keine verhungernden. Doch
die Schilderungen sind so eindringlich, dass sie auf dem
Mitternachtsmarkt in der Großstadt noch säckeweise Reis und Mehl kaufen
und am nächsten Tag zu dem Waisenhaus bringen. Als Akin, der Beniner,
die Zustände sieht, muss er beiseite gehen, um sich zu fassen. Sie
lassen die Lebensmittel vor Ort und nehmen die beiden Kinder, die am
schlimmsten betroffen sind, mit auf die Krankenstation. Sie haben noch
Hoffnung, ihnen helfen zu können. Doch beide Kinder sterben.
Das ist für Elke Kleuren-Schryvers das Schlüsselerlebnis, um neben
Krankenstation und Schule den Bau eines Waisenhauses voranzutreiben, das
sie und Hunderte von Bewohnern aus den umliegenden Dörfern während einer
späteren Expedition im Februar 1999 mit einem Volksfest unter der
Schirmherrschaft von Oberkreisdirektor
>
Rudolf Kersting fröhlich
einweihen. Aus dem verarmten Waisenhaus im Busch von Ayoumi stammt auch
Clementine, eine schwarze Frau, die dort ehrenamtlich geholfen hat.
Heute arbeitet und lebt sie in der Station Gohomè - auch als Ziehmutter
für die kleine Nongan Julienne, die im Frühjahr 1999 ihren zweiten
Geburtstag feiert - ohne ihre Zwillingsschwester Nondi Juliette, für die
auch die beste Pflege in der Station zu spät kommt. Nongan aber schafft
es. Clementine versorgt die Kleine wie ein eigenes Kind. Nongan kann
bisher ihre Beine nicht gebrauchen, doch jetzt zeigt sie erste Impulse
zu krabbeln. Ihre tote Zwillingsschwester lebt in einer uralten Beniner
Tradition weiter: An ihrer Stelle badet und ernährt Clementine
symbolisch ein Holzpüppchen.
Ende 1998 tritt die Abnabelung von Cap Anamur ein. Für die Freunde und
Förderer des humanitären Projektes in dem afrikanischen Land ändert sich
durch den neuen Namen
>
Aktion pro Humanität nichts. Nach mehr als fünf Jahren unter der
Fahne von Cap Anamur wird die Aktion selbstständig. Cap Anamur betreibt
in erster Linie Katastrophenhilfe, „Benin“ ist jedoch eine
Entwicklungsaufgabe auf lange Sicht.
„Für mich waren Christel und Rupert Neudeck die ‘Zieheltern’ meiner
humanitären Arbeit für Benin“, sagt Elke Kleuren-Schryvers, die den
Neudecks herzlich dafür dankt, dass sie das Experiment mit der Sektion
Niederrhein - als solche firmierte bisher die Benin-Aktion der
Kervenheimerin und ihrer Mitstreiter - gewagt und mit all ihrer
Erfahrung und Unterstützung begleitet haben.
Die nun eigenständige Organisation mit dem neuen Namen Aktion pro
Humanität behält ihren Sitz in der Wallstraße 4 in Kervenheim, dort wo
die Ärztin wohnt und arbeitet. Zusammen mit Bernd Vos, einem Unternehmer
aus Wetten, leitet Elke Kleuren-Schryvers in dieser Zeit die Aktion pro
Humanität und führt das Benin-Projekt in seinen zweiten Lebensabschnitt,
unterstützt durch Gisela Franzen, Erich Derricks jr. und weitere
Vorstandsmitglieder.
Eine Weihnachtsgala Ende 1998 im Uedemer Bürgerhaus und ein
spektakuläres Konzert im April 1999, bei dem Justus Frantz und die
„Philharmonie der Nationen“ in der Kevelaerer Marienbasilika musizieren,
helfen bei der Finanzierung der humanitären Arbeit in Benin. Für Ende
Januar 2001 wird eine Charity-Gala der Aktion pro Humanität in
Twistedens Plantaria vorbereitet, bei der es um das selbe Ziel geht:
Sensibilisierung für die Aufgabe, die auf die Hilfsbereitschaft der
Bevölkerung am Niederrhein angewiesen bleibt.
In zwei, drei Jahren könnte das „Centre Medical Gohomè“ auf eigenen
Füßen stehen, denn inzwischen finanzieren sich Löhne, Medikamente und
Gebrauchsmaterialien zu 70 Prozent aus den eigenen Umsätzen. 29
beninische Mitarbeiter mit einem Gesamt-Jahreslohn von 55.000 Mark sind
beschäftigt. 40 Betten stehen zur Verfügung, und die Zahl der ambulanten
Patienten steigt. Je nach Jahreszeit werden 400 bis 800 Patienten im
Monat betreut - vor allem, mit viruellen und bakteriellen Erkrankungen
des Magen- und Darmtraktes, die für Kinder häufig tödlich enden.
Die Apotheke des „Centre Medical“ ist mit WHO-Medikamenten ausgestattet,
lässt aber auch naturmedizinische Mittel zu. Das Labor ermöglicht die
direkte Blutspende, die auf Aids-Erreger und Hepatitis untersucht wird.
500 bis 600 Mal wird im Monat geimpft. Die UNICEF hat die Impfstoffe und
einen Kühlschrank für die optimale Lagerung zur Verfügung gestellt.
„Das beninische Gesundheitsministerium stufte unsere Krankenstation als
die beste und erfolgreichste ein und ernannte sie zum ‘Vorzeigeobjekt’
für staatliche Einrichtungen”, freut sich Elke Kleuren-Schryvers. Das
Waisenhaus aber kann nie „rentabel“ werden; es braucht noch lange die
Spenden hilfsbereiter Menschen vom Niederrhein.
Das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen die Kräfte vor Ort, in dem sie
nicht darauf warten, dass die Menschen zu ihnen kommen: Sie gehen in die
Dörfer, gründen Frauengruppen, die sich regelmäßig treffen, und
betreiben Altenpflege. Der Landfunk „Radio Lalo“ bringt einmal
wöchentlich eine Sendung zum Thema Gesundheit. Weiteres Standbein der
Entwicklungshilfe in Benin ist heute das Waisenhausprojekt „Jardin des
Enfants“, der „Garten der Kinder“, in dem speziell behinderte Kinder und
(Aids)-Waisen ein Zuhause finden. Auch werden bedürftige Kinder in ihren
Familien betreut. Geplant ist die Einrichtung eines
„Schulhilfeprojektes“, denn das Schulgeld von umgerechnet drei Mark pro
Kind und Schuljahr können viele Eltern nicht aufbringen. Weiterhin
sollen neue fachärztliche Schwerpunkte gelegt werden. Zum
Informationsaustausch knüpfen die Aktiven erste Kontakte zur
„Christoffel Blindenmission“ in Kamerun.
„Ein gemütliches Zurücklegen ob des Erfolges darf es nicht geben. Wir
suchen nach wie vor neue Mitarbeiter und sind dankbar für jede Spende“,
sagt Elke Kleuren-Schryvers. „Es lässt sich auch in Afrika mit Geduld,
Beständigkeit und Liebe zu den Menschen viel bewegen!“
Ihr Einsatz bewegt auch die Menschen in ihrem Heimatkreis Kleve. Als zum
25. Geburtstag des Kreises Kleve aus allen 16 Städten und Gemeinden je
ein Bürger ausgewählt wird, um für besonderes bürgerschaftliches
Engagement mit der Ehrengabe des Kreises ausgezeichnet zu werden, gehört
Elke Kleuren-Schryvers zu den Geehrten, die Ende August 2000 in der
Stadthalle Kleve die Auszeichnung in Empfang nehmen.
Inzwischen sichert eine Stiftung das Hilfswerk ab und garantiert
Kontinuität. Das erste Stiftungskapital bringt eine Stifterin aus
Kerken auf. Die im Jahr 2002 ins Leben gerufene „Stiftung Aktion pro
Humanität“ hat ihren Sitz in Kevelaer. Zweck der Stiftung sind u.a. die
Förderung der Entwicklungshilfe und die Beschaffung von Mitteln zur
Förderung der Entwicklungshilfe.
2002 arbeiten im Vorstand der Stiftung als Vorstandsvorsitzender Heinz
„Reno“ Franzen, Kervenheim, und Ernst Müller, Düsseldorf. Im Kuratorium
sind zu dieser Zeit tätig als Kuratoriumsvorsitzender Landrat Rudolf
Kersting, Kleve, als Stellvertreterin Gertrud Peters, Kerken, Sigrid
Baum, Straelen, Dr. Barbara Hendricks, Kleve, Dr. Elke
Kleuren-Schryvers, Kervenheim, Prof. Dr. Rainer Körfer, Bad Oeynhausen,
Dipl. Ing. Bernd Vos, Wetten, und Bernd Zevens, Kleve.
2006 wird Elke Kleuren-Schryvers in Kleve mit der Johanna-Sebus-Medaille geehrt. Es ist das
Jahr, in dem ihr Mann Herbert stirbt.
Für Elke Kleuren-Schryvers, die unermüdliche Ärztin, bringt das Jahr
2010 einen weiteren tiefen Einschnitt. Sie muss aus gesundheitlichen Gründen
ihre 22 Jahre zuvor gegründete Hausarztpraxis in Kervenheim aufgeben.
Kraft und Stärke, solche Schicksalsschläge anzunehmen, findet sie an den marianischen Gnadenstätten in
Kevelaer, Lourdes und Dassa in Afrika.
Zum 20-jährigen Bestehen der Afrika-Hilfe, die sich Aktion pro Humanität
nennt, kommt im August 2012 Dr. Rupert Neudeck nach Kevelaer. Er
spricht in der Klosterkirche der Klarissenschwestern über „Die neue
Kirche - Und Ihr werdet das Antlitz der Erde erneuern“.
Darum bemühen sich Elke Kleuren-Schryvers in der geistigen Nachfolge von
Albert Schweitzer und ihre Helfer der Aktion pro Humanität an ihren
Einsatzorten in Afrika jeden Tag.
![]()