 |
 |
 |
  |

|
Krickelberg, Johann Heinrich
Pfarrer in Kevelaer | * 1785 | geweiht 1813 | † 1863
![]()
 Er
war der Pfarrer mit der längsten Dienstzeit in Kevelaer - von 1817 bis
1863. Weil Johann Heinrich Krickelberg über diesen Zeitraum Tagebuch
geführt hat, verdankt ihm die Nachwelt eine lückenlose Chronik jener
Jahrzehnte. Sein Tagebuch ist zu einer der meistzitierten Quellen in der
Kevelaer-Literatur geworden.
Er
war der Pfarrer mit der längsten Dienstzeit in Kevelaer - von 1817 bis
1863. Weil Johann Heinrich Krickelberg über diesen Zeitraum Tagebuch
geführt hat, verdankt ihm die Nachwelt eine lückenlose Chronik jener
Jahrzehnte. Sein Tagebuch ist zu einer der meistzitierten Quellen in der
Kevelaer-Literatur geworden.
Er schreibt ab S. 18:
„Ich, Johann Heinrich
Krickelberg, Sohn von Johann Peter Krickelberg und Sibilla Kleven wurde
geboren zu Saeffelen im Jahre 1785, den 29. Dezember und am selbigen
Tage allda getauft, ich hielt allda meine erste hl. Communion im Jahre
1798, empfing das Hl. Sakrament der Firmung 1806 in der Pfarrkirche zu
Gangelt vom Bischof Marcus Antonius Berdolet, den 24. Julius, fing an zu
studieren, nachdem ich von der Requisition frei war, im Jahre 1807 den
7. April und studierte privat bei Herrn M. Nicolaus Imdahl, Pastor zu
Saeffelen, ging ins Seminar zu Köln 1810 den 14. November, wurde
Subdiaconus geweiht zu Namur 1813 den 3. März, Diaconus ebendaselbst den
12. Junius, und noch in demselben Jahre zu Mayntz den 18. September
Presbyter, den 26. ejusdem hielt ich in der Pfarrkirche zu Hoe[n]gen
meine erste hl. Messe, den 21. Oktober erhielt ich vom Hochwürdigsten
Vicariat von Aachen meine Adscription als Vicar der Muttergottescapelle
zu Kevelaer, den 25. Oktober kam ich schon wirklich in Kevelaer an, den
21. November reisete der dazumalige Oeconom Herr Adams [richtig:
Gerardus Aymans] vielleicht aus Ursache des Rückzuges der Franzosen
nach Aachen ab, und weil er ohne seinen Aufenthalt bekannt zu machen,
ausblieb, so wurde mir 1814 den 22. Februar vom Hochw. Vicariat in
Consilio Episcopali die Sorge der Capellen, (dieses Patent erhielt ich
den 2. März, folglich fing von diesem erst meine Sorge an) - und des
ehemaligen Oratorienhauses, oder die Oeconomie daselbst, aufgetragen.
Dem Herrn Pastor von Kevelaer habe ich vom Anfange 1814, weil er nur
allein und ein schwacher Mann war, in der Seelsorge geholfen. 1815 im
Junius habe ich aber einen Gehilfen, nämlich Herrn Janßen, Vicar zu
Hemmersbach, gebürtig aus Schierwaldenrath, als 2ten Vicar der
Muttergotteskapelle bekommen.
Im Jahr 1817 den 8. Dezember ist der Herr Pastor van Cleemputte allhier
im Oratorienhause ein Viertel über 8 morgens nach einer langwierigen
Abnehmungskrankheit gestorben. Den 12. ejusdem wurde ich zu Aachen als
Deservitor [Pfarrverwalter] der Pfarre Kevelaer angestellt und
erhielt dazu mein Instrument den 18. eiusdem.
1818 den 1. Januar wurde zu Aachen von dem Hochwürdigsten
Generalvicariat das Instrument ausgefertigt, wodurch ich als Pastor von
Kevelaer angestellt wurde, und dieses Patent erhielt ich am 3. eiusdem.
Am 20. Januar wurde ich als Pastor in der Pfarrkirche ad Stum Antonium
vom Herrn Cantonspfarrer von Geldern J. L. van Hoeke eingeführt. Die
Einführung war herrlich und sämtliche Einwohner zeigten durch den Geist,
womit sie beseelt waren, und die Mühe, die sie getan haben, daß sie ganz
zufrieden waren.“
Nach fast fünf
Jahrzehnten in Kevelaer starb Pfarrer Johann Heinrich Krickelberg in
Folge eines Gehirnschlags Anfang 1863 im Amt - da war er bereits 77
Jahre alt.
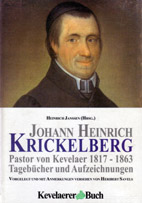 Dass
Krickelberg Tagebuch geführt hatte, wussten Insider. Aber es brauchte
fast 140 Jahre nach dem Tod des Pastors, bis sich jemand - sein
Ururgroßneffe Heribert Savels - an die Transkription wagte. 2001
erschien das 670-Seiten-Buch mit Hilfe eines großzügigen Zuschusses des
Bistums Münster zu den Herstellungskosten im Verlag des Kävels Bläche,
herausgegeben von Weihbischof
>
Heinrich Janssen,
der die Tagebücher eine „Entdeckung“ nannte.
Dass
Krickelberg Tagebuch geführt hatte, wussten Insider. Aber es brauchte
fast 140 Jahre nach dem Tod des Pastors, bis sich jemand - sein
Ururgroßneffe Heribert Savels - an die Transkription wagte. 2001
erschien das 670-Seiten-Buch mit Hilfe eines großzügigen Zuschusses des
Bistums Münster zu den Herstellungskosten im Verlag des Kävels Bläche,
herausgegeben von Weihbischof
>
Heinrich Janssen,
der die Tagebücher eine „Entdeckung“ nannte.
Krickelbergs Notizen gewähren einen detailgenauen Einblick in das Leben
der Kevelaerer und ihrer Pfarrgemeinde im 19. Jahrhundert. Über einen
derart langen Zeitraum - 50 Jahre führte Krickelberg Tagebuch - hat noch
nie jemand das Geschehen in der Marienstadt so reich und kleinteilig
beschrieben. „Ich kenne keine vergleichbare Veröffentlichung in dieser
Region“, sagte Weihbischof Heinrich Janssen bei der Vorstellung des
Werks.
Auch die Buchpräsentation im Foyer des Museums im Jahr 2001 war ein
kulturelles Ereignis. Und sie war so etwas wie eine Abschlussfeier für
alle, die in den Monaten und Jahren davor für die Herausgabe gearbeitet
hatten.
Die Vorarbeiten waren sehr aufwändig: Nach der Übertragung der in alter
Handschrift niedergelegten Bücher in Druckbuchstaben verfasste Heribert
Savels Anmerkungen zu Personen und Begriffen, prüfte Theodor Derstappen
sämtliche Fakten, klärte und erläuterte Heinrich Janssen Namen und
Begriffe aus dem klerikalen Bereich, glich Martin Willing die
ortsspezifischen Angaben mit dem Zeitungsarchiv ab und stellte ein
Namensregister und zwei Zeittafeln zusammen.
Was es alles im Krickelberg zu entdecken gibt, sollen drei Beispiele
verdeutlichen. Das eine, von Weihbischof Heinrich Janssen in seinem
Vortrag näher ausgeführt, bezieht sich auf den Bau der großen
Marienkirche, der heutigen Basilika. Krickelberg bevorzugte weniger
diesen Neubau als vielmehr eine Erweiterung der Wallfahrtskirche, die
wir heute Kerzenkapelle nennen. Wären die vorgeschlagenen Kirchenschiffe
angebaut worden, sähe die Kerzenkapelle - und mit ihr der Kapellenplatz,
an dem sich keine Basilika erheben würde - völlig anders aus. Pläne gab
es auch für eine Erweiterung der St.-Antonius-Pfarrkirche, die viel zu
klein geworden war. Diese Vergrößerung hatte Krickelberg, ganz Pastor
seiner Gemeinde, länger als 60 Jahre vor der tatsächlichen Erweiterung
(ab 1900) im Sinn.
Das zweite Beispiel für Neuigkeiten aus der Kevelaerer Heimatgeschichte,
die es zu entdecken galt, bezieht sich auf die „Doppelspitze“ in der
Führung von Pfarrei und Wallfahrt. Wer im Pfarrhaus und am Kapellenplatz
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also nach der Franzosenzeit,
von wann bis wann und vor allem für was Verantwortung trug, wurde in der
bisher veröffentlichten Literatur nicht angesprochen. Fakten,
Ämterverteilung und Amtsinhaber waren nicht oder nicht ausreichend genug
bekannt. Diese Wissenslücken konnten mit Krickelberg geschlossen werden.
Das dritte Beispiel bezieht sich auf das
>
Collegium Augustinianum in Gaesdonck.
Krickelberg ist, so wird in seinem Tagebuch nachgewiesen, der Initiator
für die Gründung eines Gymnasiums in dem Konvikt.
![]()
![]()