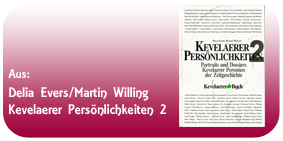|
 |
 |
  |

|
Wenzel, Karl W.
Maler aus Kevelaer | * 1887 | † 1947
![]()
 Ein Großteil seiner Werke wurde bei einem Bombenangriff auf Kevelaer
zerstört. Wenige Jahre danach, im September 1947, starb der aus
Ibbenbüren stammende Maler, der als bedeutender Künstler aus dem Kreis
der Schüler um Friedrich Stummel hervorgegangen ist.
Ein Großteil seiner Werke wurde bei einem Bombenangriff auf Kevelaer
zerstört. Wenige Jahre danach, im September 1947, starb der aus
Ibbenbüren stammende Maler, der als bedeutender Künstler aus dem Kreis
der Schüler um Friedrich Stummel hervorgegangen ist.
Karl W. Wenzel wuchs in einer musisch sehr vielseitigen Familie auf und
schaute oft seinem Vater Louis (1852 bis 1920) über die Schulter, der
ein bekannter Landschafts- und Porträtmaler war. Nach Abschluss seiner
Gymnasialzeit kam Wenzel als 19-Jähriger nach Kevelaer in das Atelier
von Friedrich Stummel, der weithin als Kirchenmaler bekannt war.
Wenzel galt, wie Peter Lingens schreibt, als der begabteste Schüler
Stummels. Von 1906 bis 1914 wirkte Wenzel an der Ausmalung der
Marienbasilika mit. Nach seiner Zeit im Stummel-Atelier arbeitete er
1921 mit
![]() Heinrich Holtmann am Kathedralchor der Basilika, das durch
Bauarbeiten stark entstellt war. Gemeinsam banden die beiden Künstler
den Chorraum wieder in den Kontext des Gesamtkunstwerkes ein. Wenzels
Tochter, Gerte Paessens-Wenzel, über ihren Vater: „[In Kevelaer] lehnte
er schon bald die in überlieferten Formen erstarrte Kunstauffassung
innerlich ab und suchte nach langen Jahren schwerer Kämpfe mit sich
selbst nach eigenen Wegen“. Seine Studienreisen führten ihn durch
Deutschland, die Schweiz, durch die Niederlande und nach Berlin.
Heinrich Holtmann am Kathedralchor der Basilika, das durch
Bauarbeiten stark entstellt war. Gemeinsam banden die beiden Künstler
den Chorraum wieder in den Kontext des Gesamtkunstwerkes ein. Wenzels
Tochter, Gerte Paessens-Wenzel, über ihren Vater: „[In Kevelaer] lehnte
er schon bald die in überlieferten Formen erstarrte Kunstauffassung
innerlich ab und suchte nach langen Jahren schwerer Kämpfe mit sich
selbst nach eigenen Wegen“. Seine Studienreisen führten ihn durch
Deutschland, die Schweiz, durch die Niederlande und nach Berlin.
Als Vorsitzender des Künstlerbundes organisierte Wenzel 1932 eine
umfangreiche Kunstausstellung in Kevelaer, die die breite Palette des
Schaffens einheimischer Maler zeigte. Offenbar weil Aufträge für ihn als
Kirchenmaler in den 30er- und 40er-Jahren ausblieben, wandte er sich in
dieser Zeit der profanen Malerei zu. Seine naturalistische Arbeit
erregte im NS-Deutschland positives Aufsehen. Aus seinem zeitangepassten
„’völkischen’ Malstil“ (Lingens) darf nach eindeutigen Aussagen seiner
Tochter Gerte Paessens-Wenzel nicht der Fehlschluss gezogen werden,
Wenzel sei ein Anhänger der Nazi-Politik gewesen. Seine Malweise in
jener Zeit - eine in der Kunstgeschichte sich immer wieder zeigende
Entwicklung - und seine so erzielten Erfolge als Maler sind ihm nicht
vorzuwerfen.
Als Wenzel nach dem Krieg nach Kevelaer zurückkehrte, das ihm ab 1906
längst zur zweiten Heimat geworden war, „fand er Heim und Atelier, auch
das Atelier im Gartenhaus Bausch, bis auf die Grundmauern von Bomben
zerstört. Was im Keller war, die besten seiner Bilder in Kisten
eingenagelt, Rahmen, Malgerät, Material, Arbeiten jahrelangen Studiums,
alle Kupferplatten, seine literarischen Werke, alles war gestohlen
worden. Nur einen kleinen Teil seiner Radierungen hatte ein Kunstfreund
retten können“.
Für Wenzel war der Verlust der künstlerischen Zeugnisse vieler Jahre
eine tiefe Erschütterung. Freunde und Verehrer gaben ihm Mut für einen
neuen Anfang. Unermüdlich schuf er neue Werke.
Doch Wenzel dachte nicht allein an sein eigenes Fortkommen. Nach dem
Krieg versuchte er eine Neubelebung des Kevelaerer Künstlerbundes, dem
er angehört hatte und dessen treibende Kraft er war. Der Bund
veranstaltete noch eine große niederrheinische Ausstellung, bei der auch
Werke von Wenzel zu sehen waren. Doch da der Künstler wenige Wochen nach
der Ausstellung starb, „ging das junge Pflänzchen des organisierten
Kevelaerer Kunstlebens bald wieder ein“, schreibt Peter Lingens in
„Unsere Heimat“ 3/1996.
In Kevelaer wurde im Januar 1967 eine viel beachtete Ausstellung von
Grafik und Bildern von Karl W. Wenzel gezeigt. Heute verfügt auch das
![]() Museum in Kevelaer über einige Werke des Künstlers: Seine Tochter aus
Bad Neuenahr-Ahrweiler hatte sie dem Verein für Heimatschutz und
Museumsförderung aus dem Nachlass ihres Vaters gestiftet, darunter eine
von
Museum in Kevelaer über einige Werke des Künstlers: Seine Tochter aus
Bad Neuenahr-Ahrweiler hatte sie dem Verein für Heimatschutz und
Museumsförderung aus dem Nachlass ihres Vaters gestiftet, darunter eine
von ![]() Will Horsten geschaffene Bronzebüste, acht gerahmte Bilder in
Aquarell und Mischtechnik aus der „Städte-Serie“ sowie vier Radierungen.
Will Horsten geschaffene Bronzebüste, acht gerahmte Bilder in
Aquarell und Mischtechnik aus der „Städte-Serie“ sowie vier Radierungen.
Zwei Radierungen von Karl W. Wenzel konnte 1994 der Verein aus einem
anderen Nachlass für eine symbolische Mark kaufen. Die Federzeichnungen
und Radierungen aus der „Städte-Serie“ waren deswegen so willkommen und
wichtig für das Kevelaerer Museum, weil diese Wenzel-Reihe die Abteilung
„Wallfahrts- und Ortsgeschichte von Kevelaer“ im neuen Teil des Museums
abschließt. Auch in der Einschätzung der Museumsleitung nimmt Karl W.
Wenzel als Maler, Musiker, Schriftsteller und Kinderbuchautor eine der
ersten Stellen im Reigen der Kevelaerer Künstler im vergangenen Jahrhundert
ein.
Die Stadt benannte eine Straße auf Kevelaer-Nord nach diesem berühmten
Mann, wo er sich im „Künstlerviertel“ mit Dürer, Stummel, Korthaus,
Grünewald, Holbein, Kolbe, Klee, Rubens, Spitzweg und Zille in illustrer
Gesellschaft befindet.
![]() Karl W. Wenzel Liebte er Brauntöne?
Karl W. Wenzel Liebte er Brauntöne?
![]()