 |
 |
  |
  |

|
|
Marpingen
Das deutsche Lourdes

 Marienerscheinungsort Marpingen im Saarland
Marienerscheinungsort Marpingen im Saarland
VON MARTIN WILLING

Marpingen im Saarland und
der Härtelwald, in dem sich die berichteten Marienerscheinungen während
des Kulturkampfs in Preußen ereignet haben. Foto: Martin Willing
(1998)
Die junge Nonne hat Kevelaer gekannt; davon ist auszugehen.
Wahrscheinlich hat sie den Ort auch besucht, denn die Gnadenstätte der
Consolatrix Afflictorum liegt ihrem Kloster so nahe wie keine andere.
Ich suche Spuren der Vorsehungsschwester Olympia, eines der Seherkinder
von Marpingen, dem „deutschen Lourdes“, wo 1876 von Marienerscheinungen
berichtet wird. Ich fahre nach Steyl bei Venlo, um das Grab der Nonne zu
finden.
Der Friedhof vor der Kapelle mit der letzten Ruhestätte des heiligen
![]() Arnold Janssen ist Brüdern vorbehalten. Ich gehe nach der
„Ausschließungsmethode“ vor und klopfe an der Pforte der
Klausurschwestern am Maasufer an. Eine ältere Nonne prüft nach: Nein,
hier hat sie nicht gelebt. Im benachbarten Kloster der
Missionsschwestern erwarte ich auch keine positive Nachricht, will aber
sicher gehen, weil auf dem Friedhof dieses Klosters noch keine Gräber
eingeebnet sind. 1905 ist Margaretha Kunz, so ihr bürgerlicher Name, in
Steyl gestorben. Ich finde einige Gräber mit diesem Sterbejahr, aber es
sind andere Schwestern.
Arnold Janssen ist Brüdern vorbehalten. Ich gehe nach der
„Ausschließungsmethode“ vor und klopfe an der Pforte der
Klausurschwestern am Maasufer an. Eine ältere Nonne prüft nach: Nein,
hier hat sie nicht gelebt. Im benachbarten Kloster der
Missionsschwestern erwarte ich auch keine positive Nachricht, will aber
sicher gehen, weil auf dem Friedhof dieses Klosters noch keine Gräber
eingeebnet sind. 1905 ist Margaretha Kunz, so ihr bürgerlicher Name, in
Steyl gestorben. Ich finde einige Gräber mit diesem Sterbejahr, aber es
sind andere Schwestern.
Nun bleibt noch das dritte Frauenkloster in Steyl, das Josefskloster.
Hierhin flüchtet 1878 das Generalat der Schwestern von der Göttlichen
Vorsehung, als Preußen alle Ordensleute, auch die Vorsehungsschwestern
in Münster, des Landes verweist.
Dass das Josefskloster in Steyl aufgehoben ist, weiß ich. „Aber der
Friedhof ist noch da“, sagt mir ein älterer Spaziergänger, den ich am
Maasufer nach dem Weg frage. Er habe früher in der Klosteranlage
gearbeitet. Ich betrete das Parkgelände, sehe links vom Haupthaus die
Klosterkirche, gehe die Treppe zum Eingang hoch und schelle. Eine Frau
öffnet und sagt, es handele sich um Privatbesitz, und der Friedhof sei
eingeebnet. Ob Grabkreuze oder Grabmale noch vorhanden seien? Nein, es
ist nichts mehr da.
So verlieren sich am Ufer der Maas die Spuren von Margaretha Kunz aus
dem Saarland, der früheren Klarissenschwester Maria Stanislaus und
späteren Vorsehungsschwester Olympia. Sogar ihr Eintrittsdatum in den
Orden der Klarissen ist nicht genau bekannt. „Als das Bistum [Trier] in
den fünfziger Jahren eine Kopie des Sterbebildchens der späteren
Schwester Olympia erhielt, war darauf vermerkt, daß sie im September
1905 starb, nachdem sie 15 Jahre Nonne gewesen war“, lese ich bei David
Blackbourn1.
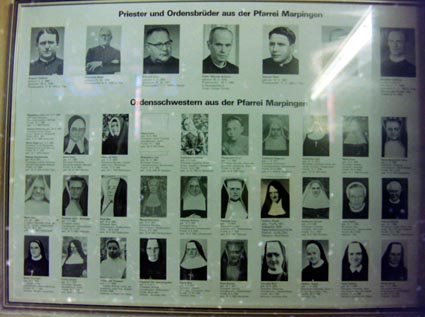 „Das ergäbe
ein Eintrittsdatum im Laufe des Jahres 1890. Die 15 Jahre könnten sich
aber auch auf ihren Eintritt in den Orden der göttlichen Vorsehung
beziehen und die kurze Zeit bei den Klarissen nicht einschließen, so daß
der Eintritt in diesen Orden schon 1889 erfolgt sein könnte.“
„Das ergäbe
ein Eintrittsdatum im Laufe des Jahres 1890. Die 15 Jahre könnten sich
aber auch auf ihren Eintritt in den Orden der göttlichen Vorsehung
beziehen und die kurze Zeit bei den Klarissen nicht einschließen, so daß
der Eintritt in diesen Orden schon 1889 erfolgt sein könnte.“
Informationstafel in der
Pfarrkirche
von Marpingen mit Daten zur Vorsehungsschwester
Olympia (Margaretha Kunz).
Wann sie ihre ewigen Gelübde als Vorsehungsschwester abgelegt hat,
erfahre ich bei meinem Besuch der Pfarrkirche von Marpingen, wo eine
Tafel mit knappen Angaben zu Priestern, Ordensbrüdern und Nonnen der
Kirchengemeinde aufgehängt ist: am 3. Oktober 1901, kaum vier Jahre vor
ihrem Tod am 3. September 1905. Margaretha Kunz wurde nur 37 Jahre alt.
Es ist Montag, der 3. Juli des Jahres 1876. In Lourdes wird gerade die
Statue der Muttergottes, nach Angaben von Bernadette Soubirous
hergestellt, feierlich gekrönt. Da steigt „Maria ... von des Himmels
Höhen auf Marpingens Waldfluren hernieder, um sich in Deutschland einen
besonderen Sitz zu bereiten, von wo sie Trost und Stärke, Liebe und
Versöhnung der streitenden Kirche spenden wollte.“2
 An
diesem Abend geht in Marpingen, einem Bergarbeiterdorf im Saarland,
Margaretha Kunz mit ihren Freundinnen Susanna Leist und Katharina
Hubertus, alle acht Jahre alt, in den Härtelwald, der einen Berg am
Dorfrand hinaufzieht. Die Kinder pflücken Waldbeeren.
An
diesem Abend geht in Marpingen, einem Bergarbeiterdorf im Saarland,
Margaretha Kunz mit ihren Freundinnen Susanna Leist und Katharina
Hubertus, alle acht Jahre alt, in den Härtelwald, der einen Berg am
Dorfrand hinaufzieht. Die Kinder pflücken Waldbeeren.
Seherkinder Susanna Leist
(stehend),
Margaretha Kunz (l.)
und Katharina Hubertus. Foto: Friedrich Ritter von
Lama,
Die Muttergotteserscheinungen in Marpingen (Saar), o. D., S. 41
Sie hören das Angelus-Läuten vom Turm der Pfarrkirche und knien nieder
zum Gebet. Plötzlich stößt Susanna Leist, so wird übereinstimmend in der
Marpingen-Literatur berichtet, einen Schrei aus. Sie zeigt den Mädchen
eine „weiße Gestalt“ am Waldrand.
„Leichenblaß“ kehren die Kinder heim, erzählen den Eltern von dem
Erlebnis, werden von ihnen eindringlich ermahnt, nicht zu lügen, gehen
am folgenden Tag wieder in den Härtelwald, beten an der gleichen Stelle
und sehen nach dem dritten „Vater unser“ eine „glänzende Gestalt“ vor
sich sitzen. Auf die Frage, wer sie sei, antwortet die Gestalt nach
Angaben der Kinder: „Ich bin die unbefleckt Empfangene“.
Die Marienerscheinungen dauern bis zum 3. September 1877 an, also über
ein Jahr, in dem das unbekannte 1600-Seelen-Dorf deutsche Geschichte
macht. Kaum eine Woche nach der ersten Erscheinung bevölkern Tausende
von Pilgern den Ort und den Wald. Es werden mehr Menschen gezählt als
zum gleichen Zeitpunkt in Lourdes, wo 18 Jahre zuvor die Muttergottes
der Bernadette erschienen ist. Am 12. Juli 1876, neun Tage nach der
Ersterscheinung, halten sich 20.000 Fremde in Marpingen auf. Auf den
Wegen zum Dorf herrscht totales Verkehrschaos. Zuerst berichten die
regionalen, dann auch die überregionalen Zeitungen. Preußen hat ein
Reizthema, das aufregt wie kaum ein zweites: Marpingen, das „deutsche
Lourdes“, fordert den aufgeklärten Staat heraus.
 Was sich aus diesem Machtkampf entwickelt, darüber berichtet der
britische Historiker David Blackbourn in seinem 700 Seiten starken Buch
„Marpingen, Apparitions of the Virgin Mary in Bismarckian Germany“, auf
das die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ Anfang 1996 zum erstenmal in
Deutschland aufmerksam macht.
Was sich aus diesem Machtkampf entwickelt, darüber berichtet der
britische Historiker David Blackbourn in seinem 700 Seiten starken Buch
„Marpingen, Apparitions of the Virgin Mary in Bismarckian Germany“, auf
das die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ Anfang 1996 zum erstenmal in
Deutschland aufmerksam macht.
Der Historiker David Blackbourn signierte in Marpingen seinen Bestseller. Foto: Martin Willing (1998).
Als 1997 der Rowohlt-Verlag eine
vorzügliche deutsche Übersetzung herausgibt, heißt es in der
„Süddeutschen Zeitung“, das Werk lese sich „teilweise spannend wie ein
Krimi“. „Die Zeit“ widmet Ende 1997 dem Buch eine über zwei Seiten
gehende Besprechung. Das Werk „dürfte für sozialliberale Historiker eine
Provokation sein. Denn Blackbourn weigert sich beharrlich, die
Marienerscheinungen in Marpingen (und anderswo) lediglich als Symptome
eines bedauerlichen Irrationalismus, eines schlimmen Rückfalls in
mittelalterlichen Aberglauben abzutun. Vielmehr nimmt er sie ganz ernst
als Ausdrucksform einer neuen Volksfrömmigkeit, deren ´einfühlender
Untersuchung` er sich verschrieben hat.“
In Wirklichkeit geht die wissenschaftliche Studie, 1996 von der American
Historical Association als „das beste neue Buch zur deutschen
Geschichte“ ausgezeichnet, dem Fall Marpingen gnadenlos sorgfältig auf
den Grund. (David Blackbourn antwortete auf einer Pressekonferenz auf
meine Frage, ob er den Erscheinungen Glauben schenke,
mit einem klaren „Nein".)
Der Kulturkampf in Preußen ist auf dem Höhepunkt, der Bischofsstuhl in
Trier verwaist, aber nur dem zuständigen Diözesanbischof fällt die
Aufgabe zu, die vom Kirchenrecht vorgeschriebene, kanonische
Untersuchung privater Offenbarungen und unerklärbarer Heilungen
einzuleiten. Bischof Korum, der fünf Jahre nach den Erscheinungen das
Trierer Amt übernimmt, verzichtet auf ein solches förmliches Verfahren,
vermutlich aus drei Gründen: Er will keine weiteren Verwerfungen mit dem
preußischen Staat provozieren, aber auch nicht - im Falle eines
negativen Urteils - „den Zivilbehörden in die Hände“ spielen (vergl.
Blackbourn, S. 545). Und er will, falls sich die Erscheinungen als
falsch herausstellen, den Gläubigen, die unter den Repressalien der
Preußen leiden, eine schwere Enttäuschung ersparen.
Die drei Seher-Mädchen werden von der Kirche „aus dem Verkehr gezogen“
und ins Frauenkloster vom armen Kinde Jesus im luxemburgischen
Echternach gesteckt, wo sie - auch ohne offizielles
Untersuchungsverfahren - zahlreichen Verhören unterworfen werden. Ob die
Eltern der achtjährigen Kinder zugestimmt haben, ist offen. Der
Klosterdirektor, Titularbischof Laurent, fällt sein Urteil über die
Vorgänge von Marpingen, indem er die schriftlichen Beschreibungen der
Kinder interpretiert: Es handele sich, so Laurent, um „nichts als eine
höllische Gaukelei“.
Der 1881 eingesetzte Trierer Bischof Korum, qua Amt dazu berufen, über
„Marpingen“ Tolerierung, Anerkennung oder Ablehnung auszusprechen, hält
das „private“ Urteil des Luxemburger Bischofs Laurents unter Verschluss,
veranlasst, dass die Kinder im Kloster bleiben, und hofft, dass sich
„Marpingen“ mit der Zeit von selbst erledigt.
Margaretha Kunz bleibt bis 1885 in Echternach und wird als 17-Jährige
das Hausmädchen eines Pfarrers in Münster, wo ihre ältere Schwester
Maria als Novizin bei den Klemensschwestern lebt. Margaretha will
ebenfalls Nonne werden, weiß aber, dass ihr dieser Schritt versagt
bleibt, solange sie als Lügnerin gilt. Nur ein positives Ergebnis eines
kanonischen Verfahrens kann sie von diesem Makel befreien, aber der neue
Bischof von Trier leitet keine solche Prüfung ein. Deshalb kann ihr nur
die Beichte helfen, in der sie eingesteht, gelogen zu haben.
Vor Ostern 1887, so ist ihrem späteren schriftlichen Geständnis zu
entnehmen, beichtet sie einem Kapuzinerpater, über die Erscheinungen
gelogen zu haben. Das gesteht sie auch der Haushälterin des Pfarrers in
Münster, bei dem sie arbeitet. Die Haushälterin berichtet dem Pfarrer,
der wiederum seinem Amtsbruder in Marpingen, der von seiner Überzeugung,
dass die Marienerscheinungen echt gewesen sind, bis zuletzt nicht
abrückt. Auf dessen Wunsch wechselt Margaretha Kunz 1888 von Münster
nach Thorn in Westpreußen, wo sie als Dienstmädchen unter dem Namen
Maria Althof in einem Kloster arbeitet. Hier schreibt sie im Januar 1889
ein umfassendes Geständnis nieder: „Ich bin eines der drei Kinder, die
vor beinahe dreizehn Jahren in Marpingen das Gerücht ausstreuten die
Mutter Gottes gesehen zu haben und muß leider das tief demütigende
Geständnis machen, dass alles ohne Ausnahme eine einzige grosse Lüge
war.“ (Blackbourn, S. 555)
Wie und aus welchem Anlass es zu diesem Geständnis gekommen ist, liegt
im dunkeln. Dass es ihre „Eintrittskarte“ zum Ordensleben ist, beweist
der Fortgang der Geschichte. Ist dieses Geständnis eine Notlüge? Dann
hätte Margaretha Kunz ihr Noviziat mit der Verleugnung einer
tatsächlichen Marienerscheinung begonnen.
Das Geständnis, von einer Schwester bestätigt, wird dem Bischof in Trier
zugeleitet, der es in einem blauen Briefumschlag mit der Aufschrift
Secretum verschließt. Das Papier wird Jahrzehnte lang geheim gehalten.
„Was Margaretha Kunz betraf, so hatte sie gebeichtet und konnte den
Status des Dienstmädchens mit dem der Novizin vertauschen“, schreibt
Blackbourn (S. 557).
Margaretha reist nach Münster, tritt in den strengen Orden der Klarissen
ein und heißt nun Schwester Maria Stanislaus. Ihre Oberin schreibt
später über ihr „sehr gutes, liebes Noviz´chen“, Margaretha habe „die
Sache mit der Erscheinung geheim halten“ müssen. Sie ist bei den
Mitschwestern gut gelitten, betet häufig vor dem Lourdes-Bild des
Klarissenklosters, redet über die Erscheinungen, denn aus einem späteren
Schreiben einer Oberin ist herauszulesen, dass „alle Ordensschwestern an
die Erscheinungen glaubten“ (Blackbourn, S. 560).
Das entspricht einem indirekten Widerruf des Geständnisses von 1889.
Margaretha Kunz muss den Klarissenorden bald verlassen, weil sie über
ihre Privatoffenbarungen kein Stillschweigen bewahrt und die
Ordensleitung wohl Untersuchungen und damit Unruhe für das klösterliche
Leben befürchtet. Margaretha wird von den Schwestern der Göttlichen
Vorsehung aufgenommen, legt 1901 als Schwester Olympia die Profess ab
und stirbt 1905 als Nonne im holländischen Steyl.
Zu diesem Zeitpunkt ist das „deutsche Lourdes“ längst vergessen. Nicht
so in Marpingen selbst. 1932 stellt der Gemeinderat öffentliches Bauland
für eine Gnadenkapelle bereit, die ein Jahr später fertig wird - aber
bis heute nicht kirchlich eingeweiht ist, weil dem Ursprungsmirakel von
Marpingen die Approbation fehlt. Während der Nazizeit wird die
ungeweihte Kapelle Zuflucht für Beter, und nach dem Krieg schwellen die
Pilgerströme wieder an. Vor dem Plebiszit im Jahre 1955 über die Zukunft
des Saarlandes (Frankreich oder Deutschland) wird in Marpingen „die
Sache der CDU weitestgehend mit der Sache der Härtelwaldkapelle
identifiziert“ (Blackbourn, S. 604), ja man spricht bereits von der
„CDU-Kapelle“.

Die 1933 errichtete Gnadenkapelle
von Marpingen. Foto: Martin Willing (1998).
Die Sozialdemokraten stehen der CDU nicht nach. In einer
Wahlkampfbroschüre zu den Kommunalwahlen 1956 heißt es: Die Zukunft
werde erweisen, daß die SPD-Kandidaten „ein offeneres Ohr haben für ein
echt christliches Anliegen unserer Gemeinde (Härtelwald), als die Herren
der allerchristlichsten CVP in der Vergangenheit hatten“. Die
Unterstützung der örtlichen SPD für die Härtelwaldbewegung, heißt es bei
Blackbourn weiter, „wurde durch Artikel in der sozialdemokratischen
Allgemeinen Zeitung in Saarbrücken verstärkt. (...) Kritisiert wurde die
mangelnde Bereitschaft der kirchlichen Stellen, die Erscheinungen
anzuerkennen oder Pfarrer Leist den Besuch des Erscheinungsortes zu
gestatten.“
Das Bistum Trier macht deutlich, dass die kirchliche Einsegnung der
Kapelle nur dann in Frage komme, wenn alle Bildnisse der „sogenannten
Marpinger Madonna“ entfernt worden seien und die Stätte zu einem reinen
Mahnmal beispielsweise für die Kriegstoten umgewandelt sei; aber auch
dann müsse sich die Kapelle erst eine „längere Zeit bewähren“.
Damit sind weder die Gläubigen in Marpingen, die an ihrer Gnadenstätte
festhalten, noch die Kommunalpolitiker einverstanden. Ende 1956
beschließt der Gemeinderat, mit einer Allparteien-Delegation zum Bischof
in Trier zu fahren und die Einsegnung der Marienstätte zu fordern. Die
Gruppe wird zu einer Unterredung empfangen, die insgesamt viereinhalb
Stunden dauert. Zum erstenmal wird einem größeren Kreis das Geständnis
von Margaretha Kunz vorgelegt. Das und die ablehnende Einschätzung von
Bischof Laurent seien die Gründe, warum die Kapelle nicht den
kirchlichen Segen erhalten könne.
Obschon Fragen offen bleiben und beispielsweise der Bürgermeister
weiterhin davon überzeugt ist, dass die Erscheinungen echt gewesen
seien, endet die Unterredung „versöhnlich“: Man einigt sich darauf, dass
die auf Gemeindegrund befindliche Kapelle in die Verantwortung der
Marpinger Kirche gegeben werde. Aber schon wenige Wochen später platzt
der „Kompromiss“: Der Gemeinderat verweigert nun die Herausgabe der
Kapelle an den Kirchenrat. „Sowohl die Christdemokraten“, berichtet
Blackbourn, „als auch die Sozialdemokraten setzten ihren
Propagandafeldzug für die Marpinger Erscheinungen fort und stellten die
Frage, warum das Dorf nicht als deutsches Lourdes oder Fátima anerkannt
worden sei.“
Trier, gescheitert mit seinem „versöhnlichen Kompromiss“, ist bestürzt.
Seitdem schweigen alle Seiten. Es wird ruhig in Marpingen.
Zunächst...
Anmerkungen:
1 David Blackbourn, Wenn ihr sie
wieder seht, fragt wer sie sei, Marienerscheinungen in Marpingen -
Aufstieg und Niedergang des deutschen Lourdes, Reinbek bei Hamburg 1997,
S. 568.
2 Marpingen und seine Gnadenmonate,
Altötting (ohne Jahreszahl; als Autor wird ein „Priester der Diözese
Münster“ bezeichnet, „der wiederholt Marpingen besucht hat“, S. 15)