 |
 |
 |
  |

|
Hauptschule in Kevelaer
Von einer Hoffnungsträgerin zum Auslaufmodell
![]()
Am 5. März
1968 starb die "gute alte" Volksschule. Aus ihr entstanden mit der
Schulreform, die an jenem Tag verabschiedet wurde, die Grundschule für
die Kleinen und die Hauptschule als dritte weiterführende Schule neben
Realschule und Gymnasium. Die Schulreformer erhofften viel: Sie wollten
zum einen die Hauptschüler höher qualifizieren, als es die Volksschule
je konnte, und zum anderen mit neuer Durchlässigkeit der Schulsysteme
Spätentwicklern den Übergang zur Realschule oder zum Gymnasium
wesentlich erleichtern. Mit dieser erhöhten Chancengerechtigkeit sollte
zugleich einhergehen, dass das Niveau der Schulabschlüsse auf breiter
Basis stieg.
Drei Hauptschulen existierten zunächst im Stadtgebiet Kevelaer: eine in
Winnekendonk, zwei in Kevelaer. Sie waren in den alten
Volksschulgebäuden untergebracht, nämlich in der Overbergschule in
Winnekendonk sowie in der St.-Antonius und der St.-Hubertus-Schule in
Kevelaer. Die Eltern entschieden darüber, ob eine der beiden
Hauptschulen in Kevelaer eine Bekenntnishauptschule sein sollte. Mit
knapper Mehrheit votierten sie gegen eine Bekenntnisschule. Also
richtete der Stadtrat Kevelaer zum 1. August 1968 zwei
Gemeinschaftshauptschulen ein.
Im Jahr darauf stand fest, dass die dritte Hauptschule, die in
Winnekendonk, nicht zu halten war. Der erste nach der kommunalen
Neuordnung gewählte Stadtrat, der nun u.a. auch für Winnekendonk
zuständig war, musste 1969 aus den drei Hauptschulen zwei machen. Die
„zu kleine“ Hauptschule in Winnekendonk wurde aufgelöst und blieb als
Filiale von Edith Stein vorläufig im Overberg-Schulgebäude
untergebracht, weil Kevelaer keinen Platz anzubieten hatte. Dort war die
Schulraumnot katastrophal.
 Die
Namen Edith Stein und Theodor Heuss besaßen die beiden
Hauptschulen bereits seit Frühjahr 1969, also schon vor der
Gebietsreform und dem Zusammenschluss zur neuen Stadt Kevelaer. Die
ersten Rektoren waren
>
Willi Dicks (Edith Stein)
und Josef Pauels (Theodor Heuss), der Anfang 1969 Schulrat im
Kreis Kempen wurde und durch
>
Albert Pannen (Januar
1970) ersetzt wurde.
Die
Namen Edith Stein und Theodor Heuss besaßen die beiden
Hauptschulen bereits seit Frühjahr 1969, also schon vor der
Gebietsreform und dem Zusammenschluss zur neuen Stadt Kevelaer. Die
ersten Rektoren waren
>
Willi Dicks (Edith Stein)
und Josef Pauels (Theodor Heuss), der Anfang 1969 Schulrat im
Kreis Kempen wurde und durch
>
Albert Pannen (Januar
1970) ersetzt wurde.
Willi Dicks, Rektor der Edith-Stein-Hauptschule.
1973 vergab der Stadtrat die Planungsarbeiten für ein neues
Hauptschulgebäude auf der Hüls - es war der Beginn eines großen
Schulzentrums, in dem heute alle weiterführenden Schulen Kevelaers
untergebracht sind. Der Schulraumgewinn kam mit dem stürmischen
Wachstum der Schulen allerdings nicht mit. 1980 demonstrierten
Edith-Stein-Schüler vor dem Rathaus gegen ihre Schulraumnot. Der
Unterricht fand teilweise auf den Gängen und unter dem Dach statt.
Pavillons sollten Abhilfe schaffen, aber die ließen auf sich warten.
 Nach
weiteren Neubauten zog Ruhe ein, die etwa 20 Jahre währen sollte. Albert
Pannen, Rektor der Theodor-Heuss-Hauptschule, ging 1984 in Pension. Zu
seinem Nachfolger wählte der Stadtrat den bis dahin amtierenden Konrektor an der
Edith-Stein-Hauptschule, Winfried Janssen. Auch bei der
Edith-Stein-Hauptschule stand ein Rektorenwechsel an, allerdings erst
1990: Für Willi Dicks kam Wolfgang Funke.
Nach
weiteren Neubauten zog Ruhe ein, die etwa 20 Jahre währen sollte. Albert
Pannen, Rektor der Theodor-Heuss-Hauptschule, ging 1984 in Pension. Zu
seinem Nachfolger wählte der Stadtrat den bis dahin amtierenden Konrektor an der
Edith-Stein-Hauptschule, Winfried Janssen. Auch bei der
Edith-Stein-Hauptschule stand ein Rektorenwechsel an, allerdings erst
1990: Für Willi Dicks kam Wolfgang Funke.
Albert Pannen, Rektor der Theodor-Heuss-Hauptschule.
Zwar schien in den 1990er-Jahren die Existenz der Hauptschule als
Schultyp gesichert zu sein, trotzdem war ein schleichender "Image"- und
damit einhergehend auch ein deutlicher Schülerverlust zu registrieren.
Der überaus starken Sogwirkung der 1986 gegründeten Realschule in
Kevelaer hatten die beiden Hauptschulen, von je einem Förderverein
unterstützt, nur wenig entgegenzusetzen. Das Ansehen der Hauptschule als
einer Schulform mit eigenem, qualifiziertem Bildungsauftrag, bröckelte.
Alles andere als ersprießlich für den Ruf der Hauptschule wirkte sich
aus, dass in Politikerkreisen ab Dezember 1992 immer wieder von einer
Schulzusammenlegung gesprochen wurde. "Wir brauchen keine zwei
Hauptschulen", sagte zum Beispiel
>
Heinz Ingenpaß (CDU). Was
der Ratsherr als eine pragmatische und schulsichernde Lösung gedacht hatte
- die Schülerzahlen waren rückläufig -, kam in der Bevölkerung eher wie ein
Signal herüber, dass die beste Zeit der Hauptschule vorüber sei. Die
unglückliche Fusionsdebatte erhielt im Frühjahr 1993 weiteren Auftrieb,
als feststand, dass die Edith-Stein-Hauptschule nicht genügend viele
Schüler für die neuen Eingangsklassen zusammenbekommen würde.
Im Jahr darauf, 1994, wurde die Idee einer Fusion der beiden Hauptschulen erstmals
in ein politisches Programm aufgenommen. Die KBV erklärte in ihrem
Wahlkampfpapier zur Kommunalwahl 1994: "Wir fordern die Zusammenlegung
der Hauptschulen im Sinne einer Stärkung dieser Schulform."
Der entscheidende Zusatz "im Sinne einer Stärkung" ging unter. Aus dem
Land hörte man eher das Gegenteil: 1995 beschloss die saarländische SPD,
in dem von ihr regierten Bundesland die Hauptschule abzuschaffen.
Davon war man in Kevelaer noch weit entfernt. Stadtdirektor
>
Heinz Paal bekannte sich Anfang
1996 zur Existenz der Hauptschule und des dreigliedrigen Schulsystems.
Und auch einer Schulfusion, von Teilen der CDU und der KBV bereits
angesprochen, erteilte er eine klare Absage.
Doch der Zug war offenbar abgefahren. In einigen Bundesländern
war in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre die Hauptschule bereits
abgeschafft und in die Realschule integriert. In drei neuen
Bundesländern (Brandenburg, Sachsen, Thüringen) war sie nach der Wende
gar nicht erst eingerichtet worden.
Der ungebremste Zuwachs der
Kevelaerer Realschule auf Kosten der Edith-Stein- und
Theodor-Heuss-Hauptschule spiegelte wider, was im ganzen Land los war:
Eltern drängten auf höherqualifizierte Schulabschlüsse ihrer Zöglinge,
und viele Arbeitgeber spielten mit, indem sie die Einstiegsbedingungen
für eine Lehre hoch und höher schraubten. Da nützte nicht mehr viel,
dass der Einzelhandelsverband Kleve im Juli 1998 eine Lanze für die
Hauptschule brach: Sie müsse erhalten werden, aber sie müsse sich auch
qualitativ weiterentwickeln.
Der Niedergang setzte sich fort: Im Juni 2000 wurde bekannt, dass
Edith Stein für das neue Schuljahr nur noch zwei Eingangsklassen
mit jeweils etwa 18 Schülern bilden konnte.
>
Andrea Wynhoff verlangte daraufhin - im Gegensatz zur Fusionsforderung
ihrer KBV -: "Die Stadt als Schulträger ist gefordert, die
Edith-Stein-Hauptschule zu unterstützen und am Leben zu erhalten".
Mit der Artikelreihe „Ich sage JA! zur Hauptschule“ leitete das
Kevelaerer Blatt Mitte 2000 eine Stützungsaktion für die angeschlagene
Hauptschule ein. Anfang 2002 besiegelten die Edith-Stein-Schule und das
>
grafische Unternehmen
Bercker ihre Zusammenarbeit für berufspraktische Einblicke der
Hauptschüler. Bei der feierlichen
Vertragsunterzeichnung waren Bürgermeister Heinz Paal, Firmenchef Ulrich
Schurer, Rektor Wolfgang Funke und andere zugegen. Der offizielle
Charakter sollte auch der Schule etwas Glanz geben.
 Die
Fusionsidee wurde Mitte 2003 erstmals von der Stadtverwaltung
aufgegriffen: Sowohl Rektor Janssen (Theodor
Heuss) als auch Rektor Funke (Edith Stein) standen ein
Jahr vor ihrer Pensionierung. Nun sei der rechte Zeitpunkt gekommen,
"über eine Neustrukturierung im Hauptschulbereich vor Ort nachzudenken",
befand die Verwaltung. Der Schulausschuss teilte einstimmig diese
Auffassung: Ab dem Schuljahr 2004/2005 werde es möglicherweise nur noch
eine Hauptschule in Kevelaer geben.
Die
Fusionsidee wurde Mitte 2003 erstmals von der Stadtverwaltung
aufgegriffen: Sowohl Rektor Janssen (Theodor
Heuss) als auch Rektor Funke (Edith Stein) standen ein
Jahr vor ihrer Pensionierung. Nun sei der rechte Zeitpunkt gekommen,
"über eine Neustrukturierung im Hauptschulbereich vor Ort nachzudenken",
befand die Verwaltung. Der Schulausschuss teilte einstimmig diese
Auffassung: Ab dem Schuljahr 2004/2005 werde es möglicherweise nur noch
eine Hauptschule in Kevelaer geben.
Winfried Janssen, Rektor der Theodor-Heuss-Hauptschule.
Im Dezember 2003 stand der Punkt auf der Tagesordnung des
Schulausschusses. Aber klar war nun nichts mehr, denn die Mehrheit der
Eltern und Lehrer beider Schulen hatte sich gegen eine Fusion
ausgesprochen. Unter dem Eindruck dieses eindeutigen Votums hob der
Ausschuss mit Mehrheit (gegen KBV und FDP) seinen empfehlenden Beschluss
zur Schulfusion, den er im Sommer gefasst hatte, wieder auf.
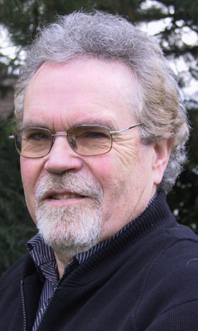 Nach
der Ausschreibung der beiden Rektorenstellen zeigte sich, dass die
potenziellen Kandidaten "dem Braten nicht trauten": Keine einzige
Bewerbung traf in Kevelaer ein. Offenbar hatte sich herumgesprochen,
dass einer der beiden neuen Rektoren im Falle einer Schulfusion auf Sand
gebaut haben würde.
Nach
der Ausschreibung der beiden Rektorenstellen zeigte sich, dass die
potenziellen Kandidaten "dem Braten nicht trauten": Keine einzige
Bewerbung traf in Kevelaer ein. Offenbar hatte sich herumgesprochen,
dass einer der beiden neuen Rektoren im Falle einer Schulfusion auf Sand
gebaut haben würde.
Wolfgang Funke, Rektor der Edith-Stein-Hauptschule.
Im Sommer 2004 legte der Stadtrat seine Scheu ab, die Fusion aktiv zu
betreiben. Zwar wurde ein KBV-Antrag zur Zusammenlegung, den Grüne und
FDP unterstützten, abgeschmettert, aber gleichzeitig beschloss die
Ratsmehrheit aus CDU und SPD, im Herbst mit den Schulkonferenzen über
eine "Zusammenlegung der Hauptschulen zu diskutieren". Das sollte der
Anfang vom Ende der beiden selbstständigen Hauptschulen sein.
Im Dezember 2004 kam die Stunde der Wahrheit. Bei nur drei
Gegenstimmen fasste der Schulausschuss den Empfehlungsbeschluss: "Der
Rat der Stadt Kevelaer beschließt, die beiden selbstständigen
Gemeinschaftshauptschulen Edith-Stein und Theodor-Heuss (...) mit
Wirkung zum Schuljahresbeginn 2005/06 (01.August 2005) zusammenzulegen.
Diese (...) neu errichtete Schule am Standort 'Auf der Hüls 1' wird als
vierzügige Gemeinschaftshauptschule im Halbtagesbetrieb geführt." Auch
der im Dezember folgende Ratsbeschluss fiel eindeutig aus. Nur fünf
Gegenstimmen aus der SPD-Fraktion wurden gezählt. Im Februar 2005
genehmigte die Bezirksregierung den Ratsbeschluss.
Der Widerstand war gebrochen. Proteste, sollte es sie noch gegeben
haben, waren nicht zu hören. Nur die Personalie "Rektor" sorgte noch für
Schlagzeilen: Es meldete sich nämlich niemand. Erst Ende 2005 - im
fünften Ausschreibungsverfahren - bewarb sich Heiner Morsch, Konrektor
einer Hauptschule in Rheinberg. Der einzige Kandidat konnte im März 2006
sein Amt antreten.
Er blieb ein Kurzzeit-Rektor: Bereits im Juni 2007 warf Morsch das
Handtuch, nachdem die Schulkonferenz der neuen Gemeinschaftshauptschule
mit deutlicher Mehrheit beschlossen hatte, den sogenannten „gebundenen
Ganztag“ abzulehnen. Schulleiter Morsch hatte darin eine „verpasste
Chance“ gesehen und die Konsequenzen gezogen.
So kam schließlich Ralph Lenninger ins Rektorenamt - freilich ohne
sogleich seinen Zusatz "kommissarischer Schulleiter" loszuwerden:
Jahrelang klagte ein Kollege aus Duisburg vor Verwaltungsgerichten, um
diesen Job zu bekommen. Erst nachdem der Konkurrent auch in
letzter Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster gescheitert
war, durfte sich Lenninger Rektor nennen.
Der Hauptschule in Kevelaer wurde keine Verschnaufpause gegönnt. 2011
überraschte die Landes-CDU mit ihrem klaren Abgesang auf diese
Schulform. Und als dann im Sommer 2011 die CDU-Führung in Berlin mit der
Idee an die Öffentlichkeit trat, die Hauptschulen in Deutschland mit den
Realschulen zusammenzulegen, war deutlich: Der Hauptschule ging der
wichtigste Unterstützer von der Fahne. Ralph Lenninger musste im Herbst
2011 einräumen: "Da der politische Wille das Verschwinden der
Hauptschule aus der Schullandschaft beschlossen hat und alles in der
Öffentlichkeit tut, um das auch durchzusetzen, ist selbst eine gut
funktionierende Schule wie unsere langfristig chancenlos."
Das Aus der Kevelaerer Gemeinschaftshauptschule wurde 2013 eingeläutet:
Der Stadtrat Kevelaer beschloss, eine Gesamtschule einzurichten, in der
die Hauptschule und die Realschule aufgehen sollen.
![]()
![]()