 |
 |
 |
  |

|
Pogromnacht
9./10. November 1938
► Vernichtung der Synagogen | Radikalisierung der Menschen
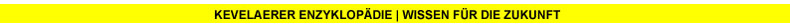
 Es
war die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, vom 9. zum 10.
November 1938. Das erste reichsweite Verbrechen gegen Leib und Leben,
Eigentum und wirtschaftliche Existenz Hunderttausender Menschen, gegen
ihre Gotteshäuser und Versammlungsstätten wurde von den Nazis zynisch
„Reichskristallnacht“ genannt. Auch die Synagogen in Geldern, Alpen,
Goch und Kleve wurden niedergebrannt.
Es
war die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, vom 9. zum 10.
November 1938. Das erste reichsweite Verbrechen gegen Leib und Leben,
Eigentum und wirtschaftliche Existenz Hunderttausender Menschen, gegen
ihre Gotteshäuser und Versammlungsstätten wurde von den Nazis zynisch
„Reichskristallnacht“ genannt. Auch die Synagogen in Geldern, Alpen,
Goch und Kleve wurden niedergebrannt.
Der Judenstern war bereits ab September 1939 im besetzten Polen eingeführt. Ab dem 1. September 1941 wurden auch die Juden im Deutschen Reich stigmatisiert.
Im Kreis Geldern waren 1938 nur zwölf jüdische Familien ansässig. Am 10. November 1938, dem Tag nach der Reichspogromnacht, in der Gelderns Synogoge von SS-Leuten niedergebrannt wurde, ließ der SS-Sturm 10/25 bis 11 Uhr die männlichen Juden in Geldern und Umgegend im Alter von 15 bis 70 Jahren durch die Polizei verhaften und in örtlichen Arrestlokalen vorläufig unterbringen. Am Tag darauf beteiligten sich Angehörige des SS-Sturms daran, die Häuser und Wohnungen der zwölf jüdischen Familien zu durchsuchen.
„Es wurden weder Waffen noch anderes Material gefunden“, berichtete der Führer des SS-Sturms 10/25, ein SS-Obersturmführer, an den SS-Sturmbann III/25. „Die Bevölkerung verhielt sich den Demonstrationen gegenüber passiv. Der Brand der Synagoge hatte eine größere Zuschauermenge angelockt, die diesem Schauspiel zusah. Da größere Geschäfte nicht vorhanden waren, ist es nicht zu Plünderungen gekommen. Ein Streifendienst zusammen mit der Polizei war deshalb nicht notwendig.“
In vielen Städten Deutschlands sah es schrecklich anders aus. Der blanke Terror, angezettelt durch organisierte Nazis, war im gesamten Reich ausgebrochen und steckte unzählige Menschen an, die sich an den unglaublichen Exzessen gegen ihre jüdischen Mitbürger nur allzu gerne beteiligten und selbst zu Tätern wurden. Wäre da nicht die alles überschattende „Endlösung“ in den Konzentrationslagern, deren Dimension die Vorstellungskraft übersteigt, dann könnte man den Pogrom vom November 1938 das wohl schändlichste Massenverbrechen einer von Unmenschlichkeit, Egoismus und Neid befallenen Gesellschaft in Deutschland nennen.
Der Gnade der Zufälligkeit in der Stadtentwicklung hat Kevelaer seine Bevorzugung zu verdanken, dass hier kein Anlass und keine Möglichkeit bestanden, es „den anderen“ am 9. November 1938 gleich zu tun: In Kevelaer wohnten keine Juden.
Aus der Wallfahrtsstadt ist in der Tat kein einziger „Zwischenfall“ in der berüchtigten „Reichskristallnacht“ überliefert. Der Pogrom spielt in der von der Stadt Kevelaer in Auftrag gegebenen Erforschung der örtlichen Geschichte zwischen Kaiserreich und Drittem Reich - das Buch erschien 1988 - in Ermangelung ortsbezogener Dokumente nicht einmal eine Nebenrolle.
Auch das eben in Auszügen zitierte, entlarvende Schreiben des SS-Obersturmführers, aus dem eindeutig hervorgeht, dass nicht „aufgebrachte Bürger“, sondern SS-Leute die Gelderner Synagoge niedergebrannt haben, wird in dem Kevelaer-Buch nicht erwähnt, obwohl der Synagogenbrand in Geldern (und Goch) zur gemeinsamen Geschichte zählt.
In dem Buch kommt außerdem zu kurz, dass der Marienwallfahrtsort, anders als viele auswechselbare Kleinstädte und trotz des auch hier nachzuweisenden Mitläufertums, in den „dunklen Jahren“ eine Zufluchtstätte für viele Menschen im weiten Umkreis war. Zwar bestand kaum ein Unterschied zu anderen Gemeinden dieser Größenordnung darin, wie sich auf der politischen und administrativen Ebene der braune Mief ausbreitete und die „kleinstädtische Machtergreifung“ in den Rathäusern zuweilen sogar komische Züge annahm.
Aber als religiöses Zentrum für einen großen Einzugsbereich bot der Marienwallfahrtsort in der NS-Zeit die Sicherheit einer letzten Insel. Es waren regelrechte Kampf-Andachten, zu denen jeden Abend auf dem dunklen Kapellenplatz Menschen kamen, die einer waffenstarrenden Umwelt den Rosenkranz entgegenhielten. Wenn wir darüber hinaus an die ungezählten Kopien des Kevelaerer Gnadenbildes denken, die in den Uniformen der Soldaten an allen Fronten steckten, dann ahnt man, was für eine stille und wichtige Rolle Kevelaer in den dunklen Jahren spielte.
Nicht nur für die Einheimischen, sondern für die ganze katholische Kirche in Deutschland wuchs unser Marienwallfahrtsort über die Normalität weit hinaus, indem Clemens August von Galen für die Zusammenkünfte von Bischöfen häufig das Priesterhaus wählte, wo sein Freund und geistlicher Bruder Wilhelm Holtmann Hausherr war. Hier in Kevelaer wurde während des Dritten Reichs Kirchengeschichte geschrieben, denn wie die Geistlichkeit auf das Vordringen des Nazitums reagieren wollte, das wurde hinter den verschlossenen Türen des ältesten Steinhauses am Kapellenplatz bedacht und beschlossen.
Die Kevelaerer Gesellschaft der 1930er-Jahre bot denkbar „schlechte“ Voraussetzungen für die nach Macht und Einfluss strebenden Nationalsozialisten. Bis 1932 bekam hier gegen die katholische Zentrumspartei niemand ein Bein auf die Erde. Auch 1933 erlangte das Zentrum in den Kreisen Kleve und Geldern die absolute Mehrheit. Es beherrschte die politische Szene, die sich aber - schwer zu greifen und zu beeinflussen - eher in lockeren Verbänden wie Nachbarschaften, Stammtischen oder Kegelclubs entwickelte. Eine klar überschaubare Organisation, die einfach zu beobachten und schließlich „auf einen Schlag“ zu vernichten wäre, bildeten die ungezählten Zentrum-Anhänger nicht.
Beeinflusst wurde der politische Meinungsbildungsprozess durch das auf die katholische Partei ausgerichtete „Kevelaerer Volksblatt“, das noch 1933 - da hatte die NSDAP bei Kommunalwahlen immerhin schon 31 Prozent der Stimmen erobert - in bemerkenswerter Deutlichkeit gegen die Nazis anschrieb. Diese Zeitung war 1879 als Organ „für Thron und Altar“ und damit als Kampfblatt des katholischen Kevelaer ins Leben gerufen worden und stemmte sich wie zahlreiche andere, meist früher gegründete Zeitungen gegen den Druck des Preußenstaates im ausgehenden Kulturkampf. Das geschah keineswegs nur auf lokaler Ebene, wie der Zeitungstitel vermuten lassen könnte.
Als in der Ausgabe vom 15. November 1938 den Lesern des „Kevelaerer Volksblatts“ die üble Schlagzeile „Deutschland und die Judenfrage“ entgegensprang, war Verleger Jakob Köster bereits "entmachtet". Die Schriftleitung lag nun in den Händen der NSDAP. In dem Artikel standen die gleichen bösartigen Verleumdungen gegen jüdische Menschen wie in den meisten Zeitungen, die inzwischen von der NSDAP „angepasst“ worden waren.
Diese erzwungene Radikalisierung der Zeitung des Kevelaerer Verlegers, der in der zweiten Generation das Verlags- und Druckhaus in der Marienstadt führte, war die folgenschwerste Untat der Nazis in Kevelaer und Umgebung der 1930er-Jahre.
Im Jahr der Reichspogromnacht gab es in Kevelaer weitere andere Opfer. Neben dem in Winnekendonk arbeitenden Amtsbürgermeister Karl Heinrich Janssen wurde sein Kollege in Kevelaer, Bernhard Widmann, aus dem Amt getrieben. Die NSDAP-Fraktion im Kevelaerer Stadtrat sammelte gegen Widmann „belastendes Material“ und schaltete „ihre“ Regierung in Düsseldorf ein. Die legte dem Bürgermeister „nahe“, sich beurlauben zu lassen.
In Winnekendonk wurde Janssen kurzerhand zwangspensioniert - ebenfalls mit an den Haaren herbeigezogenen Begründungen. Für Widmann übernahm kommissarisch dessen Aufgaben der NSDAP-Chef, womit der erste Schritt zur „Machtübernahme“ in Kevelaer - mit einiger Verspätung gegenüber anderen Regionen - getan war. An Karl Heinrich Janssen als Opfer der Nazi-Willkür erinnert inzwischen eine Gedenkplakette in Winnekendonk, wofür einer Privatinitiative zu danken ist.
An der Klimavergiftung der 1930er-Jahre beteiligte sich auch der Schriftleiter des Geldrischen Heimatkalenders, Lothar Werner. Er besaß bereits die angepasste Sprache, freilich ohne die Befähigung zum richtigen Deutsch:
► „Die Macht Judas ist im Wanken, aber um so verzweifelter sucht er es noch einmal in seinem Interesse die Völker gegeneinander aufzuputschen. Das neue Jahr [gemeint ist 1939] wird dieses Treiben in aller Stärke widerspiegeln, bis allenthalben einsichtige Staatsmänner und Volksführer sich zusammentun und ungeachtet des jüdischen Geschreis und bolschewistischer Haßausbrüche den Weg zueinander finden und damit dem wahren Frieden der Völker dienen, wozu das Großdeutsche Reich Adolf Hitlers wie stets seine Hand bieten wird.“ (Geldrischer Heimatkalender 1939, S. 36)
Während jedermann im Gelderland dieses tumbe Elaborat lesen konnte, musste die Presse, auch das „Kevelaerer Volksblatt“, die Nachricht von der Wahl des Kevelaerer Pastors Wilhelm Holtmann zum Bischof von Aachen und seiner Ablehnung durch die Regierung unterdrücken. Ab 1938 funktionierte auch in Kevelaer die Übermittlung von Informationen ohne „braunen Segen“ nur von Mund zu Mund.
Was sich während des ersten großen Pogroms gegen die Juden im November 1938 entlud, dieser Hass auf Fremdländisches und vor allem Jüdisches, konnte im Kreis Geldern in keinem direkten Zusammenhang mit tatsächlichem Einfluss von Juden stehen; der war - zwölf Familien, wenige jüdische Geschäfte, ein Warenhaus in Geldern - geradezu unbedeutend. Ein unmittelbar gelebtes und wie auch immer begründetes Hassverhältnis zu Juden hätte sich hier nicht aufbauen können.
Dass die Brandschatzung der Gelderner Synagoge zweifelsfrei eine geplante Tat von SS-Leuten und keine Reaktion „aufgebrachter Bürger“ war, machte sie zwar nicht weniger verwerflich, und auch das tatenlose Zuschauen herbeigeeilter Menschen kann heute noch bedrücken; aber der Fall kennzeichnet nicht das Denken und Fühlen der Bürger dieses Landstrichs im ausgehenden dritten Jahrzehnt.
Es muss die Leser des „Kevelaerer Volksblatts“, die bis in die zeitliche Nähe zur „Reichskristallnacht“ einen kämpferisch gegen nationalsozialistische Tendenzen anschreibenden Zeitungsverleger gewohnt waren, wie ein Hammerschlag getroffen haben, als plötzlich, etwa ab Spätsommer 1938, auch in ihrer Zeitung NS-Parolen der übelsten Sorte verbreitet wurden. Natürlich sprach sich bei interessierten Kevelaerern herum, dass Köster die Schriftleitung entzogen worden war, aber die Nichteingeweihten, und das dürften die meisten Leser gewesen sein, erfuhren für den radikalen Umschwung keine weitere Erklärung. Er hatte „einfach stattgefunden“, so wie so vieles in jener Zeit „einfach eintrat“ wie ein angeblich nicht zu änderndes Schicksal.
Dass es nur dann nicht zu ändern ist, wenn ihm zugeschaut statt widersprochen wird, ist eine der Lehren aus dem 9./10. November 1938
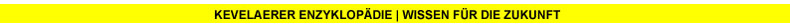
► Kevelaer und die Judenverfolgung
► Kevelaer und die NS-Zeit
► Vernichtung der Synagogen | Radikalisierung der Menschen
 Es
war die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, vom 9. zum 10.
November 1938. Das erste reichsweite Verbrechen gegen Leib und Leben,
Eigentum und wirtschaftliche Existenz Hunderttausender Menschen, gegen
ihre Gotteshäuser und Versammlungsstätten wurde von den Nazis zynisch
„Reichskristallnacht“ genannt. Auch die Synagogen in Geldern, Alpen,
Goch und Kleve wurden niedergebrannt.
Es
war die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, vom 9. zum 10.
November 1938. Das erste reichsweite Verbrechen gegen Leib und Leben,
Eigentum und wirtschaftliche Existenz Hunderttausender Menschen, gegen
ihre Gotteshäuser und Versammlungsstätten wurde von den Nazis zynisch
„Reichskristallnacht“ genannt. Auch die Synagogen in Geldern, Alpen,
Goch und Kleve wurden niedergebrannt.Der Judenstern war bereits ab September 1939 im besetzten Polen eingeführt. Ab dem 1. September 1941 wurden auch die Juden im Deutschen Reich stigmatisiert.
Im Kreis Geldern waren 1938 nur zwölf jüdische Familien ansässig. Am 10. November 1938, dem Tag nach der Reichspogromnacht, in der Gelderns Synogoge von SS-Leuten niedergebrannt wurde, ließ der SS-Sturm 10/25 bis 11 Uhr die männlichen Juden in Geldern und Umgegend im Alter von 15 bis 70 Jahren durch die Polizei verhaften und in örtlichen Arrestlokalen vorläufig unterbringen. Am Tag darauf beteiligten sich Angehörige des SS-Sturms daran, die Häuser und Wohnungen der zwölf jüdischen Familien zu durchsuchen.
„Es wurden weder Waffen noch anderes Material gefunden“, berichtete der Führer des SS-Sturms 10/25, ein SS-Obersturmführer, an den SS-Sturmbann III/25. „Die Bevölkerung verhielt sich den Demonstrationen gegenüber passiv. Der Brand der Synagoge hatte eine größere Zuschauermenge angelockt, die diesem Schauspiel zusah. Da größere Geschäfte nicht vorhanden waren, ist es nicht zu Plünderungen gekommen. Ein Streifendienst zusammen mit der Polizei war deshalb nicht notwendig.“
In vielen Städten Deutschlands sah es schrecklich anders aus. Der blanke Terror, angezettelt durch organisierte Nazis, war im gesamten Reich ausgebrochen und steckte unzählige Menschen an, die sich an den unglaublichen Exzessen gegen ihre jüdischen Mitbürger nur allzu gerne beteiligten und selbst zu Tätern wurden. Wäre da nicht die alles überschattende „Endlösung“ in den Konzentrationslagern, deren Dimension die Vorstellungskraft übersteigt, dann könnte man den Pogrom vom November 1938 das wohl schändlichste Massenverbrechen einer von Unmenschlichkeit, Egoismus und Neid befallenen Gesellschaft in Deutschland nennen.
Der Gnade der Zufälligkeit in der Stadtentwicklung hat Kevelaer seine Bevorzugung zu verdanken, dass hier kein Anlass und keine Möglichkeit bestanden, es „den anderen“ am 9. November 1938 gleich zu tun: In Kevelaer wohnten keine Juden.
Aus der Wallfahrtsstadt ist in der Tat kein einziger „Zwischenfall“ in der berüchtigten „Reichskristallnacht“ überliefert. Der Pogrom spielt in der von der Stadt Kevelaer in Auftrag gegebenen Erforschung der örtlichen Geschichte zwischen Kaiserreich und Drittem Reich - das Buch erschien 1988 - in Ermangelung ortsbezogener Dokumente nicht einmal eine Nebenrolle.
Auch das eben in Auszügen zitierte, entlarvende Schreiben des SS-Obersturmführers, aus dem eindeutig hervorgeht, dass nicht „aufgebrachte Bürger“, sondern SS-Leute die Gelderner Synagoge niedergebrannt haben, wird in dem Kevelaer-Buch nicht erwähnt, obwohl der Synagogenbrand in Geldern (und Goch) zur gemeinsamen Geschichte zählt.
In dem Buch kommt außerdem zu kurz, dass der Marienwallfahrtsort, anders als viele auswechselbare Kleinstädte und trotz des auch hier nachzuweisenden Mitläufertums, in den „dunklen Jahren“ eine Zufluchtstätte für viele Menschen im weiten Umkreis war. Zwar bestand kaum ein Unterschied zu anderen Gemeinden dieser Größenordnung darin, wie sich auf der politischen und administrativen Ebene der braune Mief ausbreitete und die „kleinstädtische Machtergreifung“ in den Rathäusern zuweilen sogar komische Züge annahm.
Aber als religiöses Zentrum für einen großen Einzugsbereich bot der Marienwallfahrtsort in der NS-Zeit die Sicherheit einer letzten Insel. Es waren regelrechte Kampf-Andachten, zu denen jeden Abend auf dem dunklen Kapellenplatz Menschen kamen, die einer waffenstarrenden Umwelt den Rosenkranz entgegenhielten. Wenn wir darüber hinaus an die ungezählten Kopien des Kevelaerer Gnadenbildes denken, die in den Uniformen der Soldaten an allen Fronten steckten, dann ahnt man, was für eine stille und wichtige Rolle Kevelaer in den dunklen Jahren spielte.
Nicht nur für die Einheimischen, sondern für die ganze katholische Kirche in Deutschland wuchs unser Marienwallfahrtsort über die Normalität weit hinaus, indem Clemens August von Galen für die Zusammenkünfte von Bischöfen häufig das Priesterhaus wählte, wo sein Freund und geistlicher Bruder Wilhelm Holtmann Hausherr war. Hier in Kevelaer wurde während des Dritten Reichs Kirchengeschichte geschrieben, denn wie die Geistlichkeit auf das Vordringen des Nazitums reagieren wollte, das wurde hinter den verschlossenen Türen des ältesten Steinhauses am Kapellenplatz bedacht und beschlossen.
Die Kevelaerer Gesellschaft der 1930er-Jahre bot denkbar „schlechte“ Voraussetzungen für die nach Macht und Einfluss strebenden Nationalsozialisten. Bis 1932 bekam hier gegen die katholische Zentrumspartei niemand ein Bein auf die Erde. Auch 1933 erlangte das Zentrum in den Kreisen Kleve und Geldern die absolute Mehrheit. Es beherrschte die politische Szene, die sich aber - schwer zu greifen und zu beeinflussen - eher in lockeren Verbänden wie Nachbarschaften, Stammtischen oder Kegelclubs entwickelte. Eine klar überschaubare Organisation, die einfach zu beobachten und schließlich „auf einen Schlag“ zu vernichten wäre, bildeten die ungezählten Zentrum-Anhänger nicht.
Beeinflusst wurde der politische Meinungsbildungsprozess durch das auf die katholische Partei ausgerichtete „Kevelaerer Volksblatt“, das noch 1933 - da hatte die NSDAP bei Kommunalwahlen immerhin schon 31 Prozent der Stimmen erobert - in bemerkenswerter Deutlichkeit gegen die Nazis anschrieb. Diese Zeitung war 1879 als Organ „für Thron und Altar“ und damit als Kampfblatt des katholischen Kevelaer ins Leben gerufen worden und stemmte sich wie zahlreiche andere, meist früher gegründete Zeitungen gegen den Druck des Preußenstaates im ausgehenden Kulturkampf. Das geschah keineswegs nur auf lokaler Ebene, wie der Zeitungstitel vermuten lassen könnte.
Als in der Ausgabe vom 15. November 1938 den Lesern des „Kevelaerer Volksblatts“ die üble Schlagzeile „Deutschland und die Judenfrage“ entgegensprang, war Verleger Jakob Köster bereits "entmachtet". Die Schriftleitung lag nun in den Händen der NSDAP. In dem Artikel standen die gleichen bösartigen Verleumdungen gegen jüdische Menschen wie in den meisten Zeitungen, die inzwischen von der NSDAP „angepasst“ worden waren.
Diese erzwungene Radikalisierung der Zeitung des Kevelaerer Verlegers, der in der zweiten Generation das Verlags- und Druckhaus in der Marienstadt führte, war die folgenschwerste Untat der Nazis in Kevelaer und Umgebung der 1930er-Jahre.
Im Jahr der Reichspogromnacht gab es in Kevelaer weitere andere Opfer. Neben dem in Winnekendonk arbeitenden Amtsbürgermeister Karl Heinrich Janssen wurde sein Kollege in Kevelaer, Bernhard Widmann, aus dem Amt getrieben. Die NSDAP-Fraktion im Kevelaerer Stadtrat sammelte gegen Widmann „belastendes Material“ und schaltete „ihre“ Regierung in Düsseldorf ein. Die legte dem Bürgermeister „nahe“, sich beurlauben zu lassen.
In Winnekendonk wurde Janssen kurzerhand zwangspensioniert - ebenfalls mit an den Haaren herbeigezogenen Begründungen. Für Widmann übernahm kommissarisch dessen Aufgaben der NSDAP-Chef, womit der erste Schritt zur „Machtübernahme“ in Kevelaer - mit einiger Verspätung gegenüber anderen Regionen - getan war. An Karl Heinrich Janssen als Opfer der Nazi-Willkür erinnert inzwischen eine Gedenkplakette in Winnekendonk, wofür einer Privatinitiative zu danken ist.
An der Klimavergiftung der 1930er-Jahre beteiligte sich auch der Schriftleiter des Geldrischen Heimatkalenders, Lothar Werner. Er besaß bereits die angepasste Sprache, freilich ohne die Befähigung zum richtigen Deutsch:
► „Die Macht Judas ist im Wanken, aber um so verzweifelter sucht er es noch einmal in seinem Interesse die Völker gegeneinander aufzuputschen. Das neue Jahr [gemeint ist 1939] wird dieses Treiben in aller Stärke widerspiegeln, bis allenthalben einsichtige Staatsmänner und Volksführer sich zusammentun und ungeachtet des jüdischen Geschreis und bolschewistischer Haßausbrüche den Weg zueinander finden und damit dem wahren Frieden der Völker dienen, wozu das Großdeutsche Reich Adolf Hitlers wie stets seine Hand bieten wird.“ (Geldrischer Heimatkalender 1939, S. 36)
Während jedermann im Gelderland dieses tumbe Elaborat lesen konnte, musste die Presse, auch das „Kevelaerer Volksblatt“, die Nachricht von der Wahl des Kevelaerer Pastors Wilhelm Holtmann zum Bischof von Aachen und seiner Ablehnung durch die Regierung unterdrücken. Ab 1938 funktionierte auch in Kevelaer die Übermittlung von Informationen ohne „braunen Segen“ nur von Mund zu Mund.
Was sich während des ersten großen Pogroms gegen die Juden im November 1938 entlud, dieser Hass auf Fremdländisches und vor allem Jüdisches, konnte im Kreis Geldern in keinem direkten Zusammenhang mit tatsächlichem Einfluss von Juden stehen; der war - zwölf Familien, wenige jüdische Geschäfte, ein Warenhaus in Geldern - geradezu unbedeutend. Ein unmittelbar gelebtes und wie auch immer begründetes Hassverhältnis zu Juden hätte sich hier nicht aufbauen können.
Dass die Brandschatzung der Gelderner Synagoge zweifelsfrei eine geplante Tat von SS-Leuten und keine Reaktion „aufgebrachter Bürger“ war, machte sie zwar nicht weniger verwerflich, und auch das tatenlose Zuschauen herbeigeeilter Menschen kann heute noch bedrücken; aber der Fall kennzeichnet nicht das Denken und Fühlen der Bürger dieses Landstrichs im ausgehenden dritten Jahrzehnt.
Es muss die Leser des „Kevelaerer Volksblatts“, die bis in die zeitliche Nähe zur „Reichskristallnacht“ einen kämpferisch gegen nationalsozialistische Tendenzen anschreibenden Zeitungsverleger gewohnt waren, wie ein Hammerschlag getroffen haben, als plötzlich, etwa ab Spätsommer 1938, auch in ihrer Zeitung NS-Parolen der übelsten Sorte verbreitet wurden. Natürlich sprach sich bei interessierten Kevelaerern herum, dass Köster die Schriftleitung entzogen worden war, aber die Nichteingeweihten, und das dürften die meisten Leser gewesen sein, erfuhren für den radikalen Umschwung keine weitere Erklärung. Er hatte „einfach stattgefunden“, so wie so vieles in jener Zeit „einfach eintrat“ wie ein angeblich nicht zu änderndes Schicksal.
Dass es nur dann nicht zu ändern ist, wenn ihm zugeschaut statt widersprochen wird, ist eine der Lehren aus dem 9./10. November 1938
► Kevelaer und die Judenverfolgung
► Kevelaer und die NS-Zeit
![]()