 |
 |
 |
  |

|
Stummel,
Friedrich
► Kevelaers bedeutender Künstler | * 1850 | † 1919
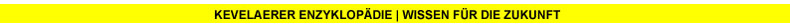
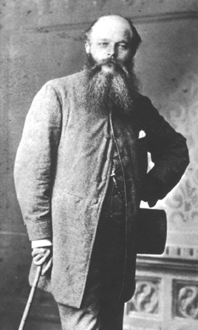 Es
dauert seine Zeit, bis Kevelaer mit der Kunstkritik umzugehen versteht,
die in den 1960er-, 70er-Jahren in dem Vorwurf gipfelt, Stummel und
seine Schüler hätten sich wertlosem Historismus hingegeben und
epigonenhaft den Stil der Kirchenmaler des Mittelalters übernommen. Die
Zeit der „Nazarener“ sei, als Stummel und seine Schüler die Basilika
ausmalten, vorbei gewesen. Ob es nicht besser sei, die Wandbilder zu
übertünchen.
Es
dauert seine Zeit, bis Kevelaer mit der Kunstkritik umzugehen versteht,
die in den 1960er-, 70er-Jahren in dem Vorwurf gipfelt, Stummel und
seine Schüler hätten sich wertlosem Historismus hingegeben und
epigonenhaft den Stil der Kirchenmaler des Mittelalters übernommen. Die
Zeit der „Nazarener“ sei, als Stummel und seine Schüler die Basilika
ausmalten, vorbei gewesen. Ob es nicht besser sei, die Wandbilder zu
übertünchen.
Glücklicherweise waren die Wallfahrtsrektoren Johannes Oomen und Richard Schulte Staade nicht dieser umstrittenen Meinung. Als 1979 das Kevelaerer Museum unter Federführung von Dr. Ulf Leinweber eine erste umfassende Stummel-Ausstellung präsentierte und dazu einen wichtigen Katalog publizierte, konnte jeder Interessierte nachvollziehen, dass in der Marienstadt mit dem Stummel-Werk ein wertvolles Kapitel der Kunstgeschichte geschrieben worden ist. Spätestens durch den Beitrag von Astrid Grittern in der KB-Beilage „Unsere Heimat“ Ende 1996, die in Kurzfassung Erkenntnisse aus ihrer 1999 veröffentlichten Dissertation („Die Marienbasilika zu Kevelaer“) vorwegnahm, fand das Stummel-Werk vor einem breiten Publikum seine gerechte Beurteilung.
Friedrich Franz Maria Stummel wird 1850 in Münster geboren. Seine Mutter unterhält dort ein Atelier für Damenkonfektion. Was sein Vater beruflich macht, ist nicht bekannt. Friedrich besucht die Domschule in Münster und - nach dem Umzug der Eltern nach Osnabrück - das dortige Gymnasium. Hier betreibt Vater Stummel - erfolglos - ein Geschäft für Fotografie.
Dank eines Stipendiums der Regierung kann Friedrich Stummel 1878 eine mehrmonatige Italienreise unternehmen - die erste von insgesamt 18. Stummel arbeitet unter Ludwig Seitz an den Chorfresken im Dom von Treviso und unter Prof. Friedrich Geselschap in Rom. Geselschap ist von Stummel so überzeugt, dass er ihn ab 1880 für Aufträge nach Berlin verpflichtet.
Stummels Zusammenarbeit mit dem Kirchenmaler Geselschap - sie gestalten in Berlin das Zeughaus aus und konzipieren Kartons zu den Mosaiken für die Fassade des Kunstgewerbemuseums - gilt zwar als erfolgreich, doch Stummel leidet an der Großstadt. Er gesteht seinem Freund Wolff in Kalkar, wie unglücklich er sich in Berlin fühle („eine öde Wüste“), und bittet ihn, ihm irgendein „Kirchlein“ am Niederrhein zu vermitteln, das er ausmalen dürfe.
Wolff macht den Kevelaerer Wallfahrtsrektor Joseph van Ackeren auf den Künstler aufmerksam, was „den Stein ins Rollen“ bringt: Der Pastor, den nackten Grauputz in der Basilika vor Augen, unterbreitet Stummel kein Angebot für ein „Kirchlein“, sondern eines für ein ganzes Künstlerleben. In Kevelaer wartet eine überwältigende Aufgabe auf ihn.
Stummel ist erschreckt und fasziniert zugleich. Er schickt sein Probebild „Maria überreicht dem Hl. Dominikus den Rosenkranz“ und reist bald darauf in die Marienstadt. Stummel wird eingeladen, im Juni und August 1881 zwei Gewölbekappen mit Ornamenten in der Beichtkapelle zu gestalten. Über der Tür malt er das Bild „Maria Magdalena salbt den Heiland“ - Probewerke, die es nun zu begutachten gilt. Eine von van Ackeren einberufene, hochkarätig besetzte Kommission prüft Stummels Arbeit. Man ist sicher: „Stummel ist unser Mann.“ Er wird beauftragt, erst einmal die Beichtkapelle auszumalen, um Erfahrungen für den großen Auftrag der Basilika-Ausgestaltung zu sammeln.
Stummels Werk in Kevelaer kann beginnen.
Es geht nicht allein um die Ausmalung einer Kirche; es geht bei dem „Projekt Kevelaer“ auch um die Wiederbelebung der sakralen Kunst des Mittelalters, die von einflussreichen Geistlichen des Rheinlandes besonders gefördert wird. Die Auftraggeber, aber auch Stummel selbst erkennen sofort ein Defizit: Er hat Schwächen in der Monumentalmalerei. Im Einvernehmen mit dem Priesterhaus begibt sich der Künstler auf eine neunmonatige Italienreise, um sich durch Studien der Mosaik- und Freskenzyklen in Venedig, Padua, Florenz, Siena, Assisi und Rom weiterzuentwickeln. Nach seiner Rückkehr nimmt er im Priesterhaus Wohnung und bezieht hier ein Atelier. 1882 beginnt Stummel mit dem Wandgemälde des Jüngsten Gerichts in der Beichtkapelle.
Ein Jahr später stellt er Heinrich Lamers (Kleve) als wohl ersten Gehilfen des Ateliers ein. 1884 kauft Stummel von einem Bäcker ein Haus an der Amsterdamer (heute: Egmont-) Straße, in das er, seine Eltern und seine Schwester Johanna einziehen. An das Wohnhaus wird ein Atelier angebaut. Im selben Jahr tritt mit Heinrich Derix, dem Vater von Hein Derix, nach Heinrich Lamers und Albert Kreusch ein dritter Schüler ins Atelier ein.
Erste „Fremdaufträge“ treffen ein, und Stummel, der Workaholic, nimmt sie an: Er arbeitet 1885 in Anholt, Keeken und Kleve, beteiligt sich an Ausstellungen, bekommt weitere Aufträge und beginnt, sein Atelier, das zu einem Großunternehmen für sakrale Kunst werden wird, auszudehnen: Er gründet im Dezember 1885 eine Mal- und Zeichenschule in Kevelaer, in der er die dringend benötigten Helfer selbst ausbilden will. Mindestens 59 Schüler werden es am Ende sein, die in Stummels Atelier gelernt und gearbeitet haben.
1887 wird das mittlere Chorfenster für die neue St.-Urbanus-Kirche in Winnekendonk von der Glasmalerei Derix in Goch nach Entwürfen Stummels hergestellt. Im Jahr darauf malt Stummel die Decke der Gnadenkapelle mit Szenen aus der Lauretanischen Litanei und aus dem Marienleben auf Goldgrund mit reicher Ornamentik aus. Stummels Neo-Renaissance-Malereien mit Stuckdekor werden von Jakob Holtmann ausgeführt.
Ein Schicksalsschlag wirft Friedrich Stummel, beruflich längst ein gemachter Mann, beinahe aus der Bahn. Er verliebt sich in seine neue Schülerin Maria von Winckler, die 1889 in sein Atelier aufgenommen worden ist, und macht ihr einen Heiratsantrag. Maria lehnt ab, weil sie nach ihrer Kunstausbildung in den Ursulinenorden eintreten will. Stummel fühlt sich elend und ist, da völlig überarbeitet, einem Zusammenbruch nahe. Der Unglückliche begibt sich zur Kur nach Bad Königstein im Taunus. Von dort aus besucht er in Wiesbaden die Familie seiner geliebten Schülerin und lernt Marias jüngere Schwester, Helene von Winckler, kennen. Stummel ist wie umgewandelt: Sofort verliebt er sich in die 22-Jährige, und beide feiern noch während des Kuraufenthalts Verlobung.
Stummel kauft 1890 - einige Wochen vor seiner Heirat im August - am Markt in Kevelaer ein Haus. Helene Stummel wird in ihren Erinnerungen über ihren Mann und sich schreiben: „So erregte seine Heirat natürlich die größte Spannung, und ich wurde scharf aufs Korn genommen, was mir zunächst ganz lustig vorkam. Ich sollte aber erfahren, daß es nirgendwo schwerer vergolten wird, nicht wie alle anderen zu sein, als in einem Ort wie Kevelaer“. Aus der Ehe gehen vier Kinder hervor.
Ende Juni 1891, nach zehnjähriger Vorbereitung, beginnt sie endlich - die Ausmalung der Marienbasilika. Der Künstler und seine Helfer fangen im Antoniuschor an.
Stummel und seine Schüler arbeiten - parallel zu ihrem Kevelaer-Auftrag - auch in Kranenburg, Lobberich, Sonsbeck, Weeze, Osnabrück, Griethausen, Rees, Marienbaum, Dülken, ab 1895 in Aengenesch, Aachen, Bracht und Lüdinghausen, Köln, Luxemburg, Pelplin, ab 1896 in Moers, Witten und Billerbeck.
1896 baut Stummel an der Gelderner Straße 29 ein neues Atelier. Die Familie wohnt weiterhin an der Amsterdamer Straße. Als 1897 die Ausmalung des Josef- und Marienchores in der Basilika vollendet ist, nimmt das Großunternehmen Stummel Arbeiten in Grieth, Hartefeld, Kranenburg, Appeldorn, Duisburg-Meiderich, Waldniel und Tönisberg an. Geistliche, die den Wallfahrtsort in Scharen besuchen und Stummels Arbeiten sehen, geben sich im Atelier als potenzielle Auftraggeber die Klinke in die Hand. 1899 bekommt Stummel den königlichen Kronenorden IV. Klasse verliehen.
Seine Frau Helene entwickelt sich zu einer führenden Künstlerin der Paramentik. Sie initiiert die Gründung eines Stickvereins in Kevelaer, der im Paramentenverein weiterbesteht.
Glasmaler Derix lässt 1900 vom Architekten Caspar Clemens Pickel in Nachbarschaft zu Stummels Atelier an der Gelderner Straße 31 und 33 ein architektonisch verwandtes Haus (Atelier und Wohnung) bauen, worin sich die enge künstlerische und unternehmerische Verbindung zwischen Stummel und Derix ausdrückt. Daneben stehen Wohnhaus und Atelier von Heinrich Holtmann, gegenüber das des Bildhauers Jakob Holtmann und dort nebenan Atelier und Wohnhaus von Josef Renard. In der Nachbarschaft wohnen Bildhauer Dierkes und Stummel-Schüler Schoofs. Im Stummel-Atelier selbst lebt längere Zeit Maler Josef Cürvers und - am Bahnhof - Maler Knautz.
Diese „Ballung“ zeigt, dass Kevelaer dank Stummel eine Gemeinde der Künstler geworden ist. Stummels Unternehmen zieht immer weitere Künstler an.
Als 1904 die Ausmalung des Johanneschores in der Basilika unter starker Beteiligung des inzwischen selbstständigen Heinrich Holtmann vollendet ist, gefährdet ein besonderes Angebot an Stummel das Basilika-Projekt: Er soll die Professur an der Hochschule zu Berlin-Charlottenburg für mittelalterliche Malerei übernehmen. Aber Stummel lehnt ab. Er hat als Kirchenmaler bereits einen solchen Ruf erworben, dass er - 1907 - im Herder'schen Konversationslexikon mit einem eigenen Stichwort geführt wird.
1909 beginnt in der Basilika die Ausmalung der Vierung und des südlichen Querschiffs (bis 1912), 1913 folgt die des Nordquerhauses (bis 1916).
Zu einem Eklat kommt es 1917, im vorletzten Jahr des Weltkrieges. Stummel hat für vier kleinere Wandfelder unter der Nebenorgelbühne - im linken Kreuzarm der Basilika - Szenen entworfen, die das Elend des gerade tobenden Krieges drastisch zeigen. Josef Cürvers hat die Malereien ausgeführt. Ausgerechnet in der als liberal geltenden „Kölnischen Zeitung“ (28.7.1917) erscheint eine heftige Kritik an diesen Darstellungen, die der Kriegspropaganda zuwider laufen.
Die Kritik wird auf höchster Ebene verhandelt. Die Regierung drängt auf Entfernung. Stummel will die Wandbilder retten und schlägt dem Kevelaerer Wallfahrtsrektor vor, die Nationalembleme ins Unverfängliche zu verändern, notfalls könne er die Szenen in den Dreißigjährigen Krieg verlegen. Pastor Peter Kempkes, auf Stummels Seite, muss dem Druck nachgeben, als auch der Bischof von Münster darauf besteht, dass die Elendsbilder übertüncht werden. 1918 werden die Stummel/ Cürvers- Wandbilder unsichtbar gemacht (Der Lusitania-Skandal).
Es ist das letzte Lebensjahr von Friedrich Stummel. Monatelang ist er krank, dann ereilt ihn ein Schlaganfall, in dessen Folge Stummel Mitte September 1919 in Kevelaer stirbt. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof im Marienpark.
Die gerade begonnenen Gewölbemalereien im Chor der Basilika werden nach Stummels Tod unter Leitung von Heinrich Holtmann in enger Zusammenarbeit mit Karl Wenzel fortgeführt. Holtmann nimmt zum Teil gravierende Änderungen der Pläne vor.
Mit dem Tod Stummels bricht die Leitfigur weg, der Garant für Aufträge, von denen inzwischen Dutzende Künstler in Kevelaer profitieren. Zusätzlich beschwert durch die Not der Nachkriegsjahre, erfasst viele Künstler Existenzangst. Sie schließen sich 1920 zum „Kevelaerer Künstlerbund“ zusammen, der als Berufsverband dem drohenden Auftragsmangel entgegenwirken soll. Aber die Zeichen sind nicht günstig. Das Generalvikariat kündigt bereits an, weitere Ausmalungen der Basilika zu den bis dahin vereinbarten Kosten nicht mehr zu genehmigen. Es werden preiswertere Materialien eingesetzt (z.B. Schlagsilber statt Blattgold).
1925 malt Heinrich Holtmann die Nischen unter den zugemauerten Apsisfenstern der Basilika mit Engelfiguren aus. Als diese Arbeiten 1926 beendet sind, ist die Basilikaausmalung nach 35 Jahren zunächst abgeschlossen. Mit der Vollendung der von Stummel begonnenen Ausmalung der Beichtkapelle durch seine Schüler und - 1936 - mit dem Entwurf des Malers Ludwig Baur (Telgte) für das Westfenster im Südquerhaus der Marienkirche („Maria Mittlerin der Gnaden“) endet die große Stummel-Zeit in Kevelaer.
Stummels Bedeutung für Kevelaer manifestiert sich nur zu einem Teil in den farbenprächtigen Historienmalereien der Gotteshäuser am Kapellenplatz. Der Maler schafft die Grundlagen für das Charisma der modernen Wallfahrtsstadt, die sich heute auch als „Stadt der Kunst und des Kunsthandwerks“ definiert. Erst das künstlerische Element, dem Einmaligkeit inne wohnt, begründet überzeugend den „Unverwechselbar“-Slogan.
Stummels mindestens 59 Schüler und weitere Kunstschaffende und Kunsthandwerker, die der Ausnahme-Künstler anzog, legten das human capital an, das sich verzinst und in die zweite oder dritte Generation übertragen hat. Von diesem Kapital zehrt der Ort fortdauernd. Die heutige Ansammlung von künstlerisch und kunsthandwerklich Tätigen in Kevelaer ist durchaus vergleichbar mit der zu Stummels Zeiten, gleichwohl, ihr fehlt die Leitfigur eines Stummel.
Er war vielleicht der bedeutendste Künstler, der je in der Marienstadt gewirkt hat.
► Kevelaers bedeutender Künstler | * 1850 | † 1919
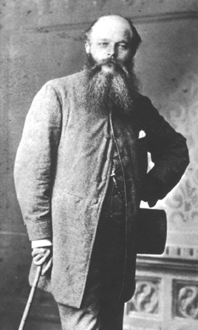 Es
dauert seine Zeit, bis Kevelaer mit der Kunstkritik umzugehen versteht,
die in den 1960er-, 70er-Jahren in dem Vorwurf gipfelt, Stummel und
seine Schüler hätten sich wertlosem Historismus hingegeben und
epigonenhaft den Stil der Kirchenmaler des Mittelalters übernommen. Die
Zeit der „Nazarener“ sei, als Stummel und seine Schüler die Basilika
ausmalten, vorbei gewesen. Ob es nicht besser sei, die Wandbilder zu
übertünchen.
Es
dauert seine Zeit, bis Kevelaer mit der Kunstkritik umzugehen versteht,
die in den 1960er-, 70er-Jahren in dem Vorwurf gipfelt, Stummel und
seine Schüler hätten sich wertlosem Historismus hingegeben und
epigonenhaft den Stil der Kirchenmaler des Mittelalters übernommen. Die
Zeit der „Nazarener“ sei, als Stummel und seine Schüler die Basilika
ausmalten, vorbei gewesen. Ob es nicht besser sei, die Wandbilder zu
übertünchen. Glücklicherweise waren die Wallfahrtsrektoren Johannes Oomen und Richard Schulte Staade nicht dieser umstrittenen Meinung. Als 1979 das Kevelaerer Museum unter Federführung von Dr. Ulf Leinweber eine erste umfassende Stummel-Ausstellung präsentierte und dazu einen wichtigen Katalog publizierte, konnte jeder Interessierte nachvollziehen, dass in der Marienstadt mit dem Stummel-Werk ein wertvolles Kapitel der Kunstgeschichte geschrieben worden ist. Spätestens durch den Beitrag von Astrid Grittern in der KB-Beilage „Unsere Heimat“ Ende 1996, die in Kurzfassung Erkenntnisse aus ihrer 1999 veröffentlichten Dissertation („Die Marienbasilika zu Kevelaer“) vorwegnahm, fand das Stummel-Werk vor einem breiten Publikum seine gerechte Beurteilung.
Friedrich Franz Maria Stummel wird 1850 in Münster geboren. Seine Mutter unterhält dort ein Atelier für Damenkonfektion. Was sein Vater beruflich macht, ist nicht bekannt. Friedrich besucht die Domschule in Münster und - nach dem Umzug der Eltern nach Osnabrück - das dortige Gymnasium. Hier betreibt Vater Stummel - erfolglos - ein Geschäft für Fotografie.
Friedrich bricht als 16-Jähriger die gymnasiale Ausbildung ab und beginnt ein Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie, das sich bis 1878/79 hinzieht. Die verarmten Eltern und zwei Schwestern ziehen zu ihm nach Düsseldorf. Der junge Mann muss wesentlich zum Unterhalt der Familie beitragen und verdient neben seinem Studium Geld. Er gibt Privatunterricht, zeichnet für eine Modezeitschrift und bemalt Gegenstände wie Spazierstöcke.
Nach seinem Akademiestudium lernt Stummel bei Prof. Eduard von Gebhardt weiter, von dem er später sagen wird: „Was ich kann, verdanke ich Gebhardt.“ Der vielseitige, lebenslustige Künstler leitet in Düsseldorf einen Kirchenchor, engagiert sich in der Seelsorge und zählt zu den führenden Organisatoren der Kostümfeste des Düsseldorfer Künstlerbundes „Malkasten“. Stummel durchwandert u.a. den Niederrhein und lernt den Kalkarer Vikar Wolff kennen, mit dem er sich anfreundet.Dank eines Stipendiums der Regierung kann Friedrich Stummel 1878 eine mehrmonatige Italienreise unternehmen - die erste von insgesamt 18. Stummel arbeitet unter Ludwig Seitz an den Chorfresken im Dom von Treviso und unter Prof. Friedrich Geselschap in Rom. Geselschap ist von Stummel so überzeugt, dass er ihn ab 1880 für Aufträge nach Berlin verpflichtet.
Stummels Zusammenarbeit mit dem Kirchenmaler Geselschap - sie gestalten in Berlin das Zeughaus aus und konzipieren Kartons zu den Mosaiken für die Fassade des Kunstgewerbemuseums - gilt zwar als erfolgreich, doch Stummel leidet an der Großstadt. Er gesteht seinem Freund Wolff in Kalkar, wie unglücklich er sich in Berlin fühle („eine öde Wüste“), und bittet ihn, ihm irgendein „Kirchlein“ am Niederrhein zu vermitteln, das er ausmalen dürfe.
Wolff macht den Kevelaerer Wallfahrtsrektor Joseph van Ackeren auf den Künstler aufmerksam, was „den Stein ins Rollen“ bringt: Der Pastor, den nackten Grauputz in der Basilika vor Augen, unterbreitet Stummel kein Angebot für ein „Kirchlein“, sondern eines für ein ganzes Künstlerleben. In Kevelaer wartet eine überwältigende Aufgabe auf ihn.
Stummel ist erschreckt und fasziniert zugleich. Er schickt sein Probebild „Maria überreicht dem Hl. Dominikus den Rosenkranz“ und reist bald darauf in die Marienstadt. Stummel wird eingeladen, im Juni und August 1881 zwei Gewölbekappen mit Ornamenten in der Beichtkapelle zu gestalten. Über der Tür malt er das Bild „Maria Magdalena salbt den Heiland“ - Probewerke, die es nun zu begutachten gilt. Eine von van Ackeren einberufene, hochkarätig besetzte Kommission prüft Stummels Arbeit. Man ist sicher: „Stummel ist unser Mann.“ Er wird beauftragt, erst einmal die Beichtkapelle auszumalen, um Erfahrungen für den großen Auftrag der Basilika-Ausgestaltung zu sammeln.
Stummels Werk in Kevelaer kann beginnen.
Es geht nicht allein um die Ausmalung einer Kirche; es geht bei dem „Projekt Kevelaer“ auch um die Wiederbelebung der sakralen Kunst des Mittelalters, die von einflussreichen Geistlichen des Rheinlandes besonders gefördert wird. Die Auftraggeber, aber auch Stummel selbst erkennen sofort ein Defizit: Er hat Schwächen in der Monumentalmalerei. Im Einvernehmen mit dem Priesterhaus begibt sich der Künstler auf eine neunmonatige Italienreise, um sich durch Studien der Mosaik- und Freskenzyklen in Venedig, Padua, Florenz, Siena, Assisi und Rom weiterzuentwickeln. Nach seiner Rückkehr nimmt er im Priesterhaus Wohnung und bezieht hier ein Atelier. 1882 beginnt Stummel mit dem Wandgemälde des Jüngsten Gerichts in der Beichtkapelle.
Ein Jahr später stellt er Heinrich Lamers (Kleve) als wohl ersten Gehilfen des Ateliers ein. 1884 kauft Stummel von einem Bäcker ein Haus an der Amsterdamer (heute: Egmont-) Straße, in das er, seine Eltern und seine Schwester Johanna einziehen. An das Wohnhaus wird ein Atelier angebaut. Im selben Jahr tritt mit Heinrich Derix, dem Vater von Hein Derix, nach Heinrich Lamers und Albert Kreusch ein dritter Schüler ins Atelier ein.
Erste „Fremdaufträge“ treffen ein, und Stummel, der Workaholic, nimmt sie an: Er arbeitet 1885 in Anholt, Keeken und Kleve, beteiligt sich an Ausstellungen, bekommt weitere Aufträge und beginnt, sein Atelier, das zu einem Großunternehmen für sakrale Kunst werden wird, auszudehnen: Er gründet im Dezember 1885 eine Mal- und Zeichenschule in Kevelaer, in der er die dringend benötigten Helfer selbst ausbilden will. Mindestens 59 Schüler werden es am Ende sein, die in Stummels Atelier gelernt und gearbeitet haben.
1887 wird das mittlere Chorfenster für die neue St.-Urbanus-Kirche in Winnekendonk von der Glasmalerei Derix in Goch nach Entwürfen Stummels hergestellt. Im Jahr darauf malt Stummel die Decke der Gnadenkapelle mit Szenen aus der Lauretanischen Litanei und aus dem Marienleben auf Goldgrund mit reicher Ornamentik aus. Stummels Neo-Renaissance-Malereien mit Stuckdekor werden von Jakob Holtmann ausgeführt.
Ein Schicksalsschlag wirft Friedrich Stummel, beruflich längst ein gemachter Mann, beinahe aus der Bahn. Er verliebt sich in seine neue Schülerin Maria von Winckler, die 1889 in sein Atelier aufgenommen worden ist, und macht ihr einen Heiratsantrag. Maria lehnt ab, weil sie nach ihrer Kunstausbildung in den Ursulinenorden eintreten will. Stummel fühlt sich elend und ist, da völlig überarbeitet, einem Zusammenbruch nahe. Der Unglückliche begibt sich zur Kur nach Bad Königstein im Taunus. Von dort aus besucht er in Wiesbaden die Familie seiner geliebten Schülerin und lernt Marias jüngere Schwester, Helene von Winckler, kennen. Stummel ist wie umgewandelt: Sofort verliebt er sich in die 22-Jährige, und beide feiern noch während des Kuraufenthalts Verlobung.
Stummel kauft 1890 - einige Wochen vor seiner Heirat im August - am Markt in Kevelaer ein Haus. Helene Stummel wird in ihren Erinnerungen über ihren Mann und sich schreiben: „So erregte seine Heirat natürlich die größte Spannung, und ich wurde scharf aufs Korn genommen, was mir zunächst ganz lustig vorkam. Ich sollte aber erfahren, daß es nirgendwo schwerer vergolten wird, nicht wie alle anderen zu sein, als in einem Ort wie Kevelaer“. Aus der Ehe gehen vier Kinder hervor.
Ende Juni 1891, nach zehnjähriger Vorbereitung, beginnt sie endlich - die Ausmalung der Marienbasilika. Der Künstler und seine Helfer fangen im Antoniuschor an.
Stummel und seine Schüler arbeiten - parallel zu ihrem Kevelaer-Auftrag - auch in Kranenburg, Lobberich, Sonsbeck, Weeze, Osnabrück, Griethausen, Rees, Marienbaum, Dülken, ab 1895 in Aengenesch, Aachen, Bracht und Lüdinghausen, Köln, Luxemburg, Pelplin, ab 1896 in Moers, Witten und Billerbeck.
1896 baut Stummel an der Gelderner Straße 29 ein neues Atelier. Die Familie wohnt weiterhin an der Amsterdamer Straße. Als 1897 die Ausmalung des Josef- und Marienchores in der Basilika vollendet ist, nimmt das Großunternehmen Stummel Arbeiten in Grieth, Hartefeld, Kranenburg, Appeldorn, Duisburg-Meiderich, Waldniel und Tönisberg an. Geistliche, die den Wallfahrtsort in Scharen besuchen und Stummels Arbeiten sehen, geben sich im Atelier als potenzielle Auftraggeber die Klinke in die Hand. 1899 bekommt Stummel den königlichen Kronenorden IV. Klasse verliehen.
Seine Frau Helene entwickelt sich zu einer führenden Künstlerin der Paramentik. Sie initiiert die Gründung eines Stickvereins in Kevelaer, der im Paramentenverein weiterbesteht.
Glasmaler Derix lässt 1900 vom Architekten Caspar Clemens Pickel in Nachbarschaft zu Stummels Atelier an der Gelderner Straße 31 und 33 ein architektonisch verwandtes Haus (Atelier und Wohnung) bauen, worin sich die enge künstlerische und unternehmerische Verbindung zwischen Stummel und Derix ausdrückt. Daneben stehen Wohnhaus und Atelier von Heinrich Holtmann, gegenüber das des Bildhauers Jakob Holtmann und dort nebenan Atelier und Wohnhaus von Josef Renard. In der Nachbarschaft wohnen Bildhauer Dierkes und Stummel-Schüler Schoofs. Im Stummel-Atelier selbst lebt längere Zeit Maler Josef Cürvers und - am Bahnhof - Maler Knautz.
Diese „Ballung“ zeigt, dass Kevelaer dank Stummel eine Gemeinde der Künstler geworden ist. Stummels Unternehmen zieht immer weitere Künstler an.
Als 1904 die Ausmalung des Johanneschores in der Basilika unter starker Beteiligung des inzwischen selbstständigen Heinrich Holtmann vollendet ist, gefährdet ein besonderes Angebot an Stummel das Basilika-Projekt: Er soll die Professur an der Hochschule zu Berlin-Charlottenburg für mittelalterliche Malerei übernehmen. Aber Stummel lehnt ab. Er hat als Kirchenmaler bereits einen solchen Ruf erworben, dass er - 1907 - im Herder'schen Konversationslexikon mit einem eigenen Stichwort geführt wird.
1909 beginnt in der Basilika die Ausmalung der Vierung und des südlichen Querschiffs (bis 1912), 1913 folgt die des Nordquerhauses (bis 1916).
Zu einem Eklat kommt es 1917, im vorletzten Jahr des Weltkrieges. Stummel hat für vier kleinere Wandfelder unter der Nebenorgelbühne - im linken Kreuzarm der Basilika - Szenen entworfen, die das Elend des gerade tobenden Krieges drastisch zeigen. Josef Cürvers hat die Malereien ausgeführt. Ausgerechnet in der als liberal geltenden „Kölnischen Zeitung“ (28.7.1917) erscheint eine heftige Kritik an diesen Darstellungen, die der Kriegspropaganda zuwider laufen.
Die Kritik wird auf höchster Ebene verhandelt. Die Regierung drängt auf Entfernung. Stummel will die Wandbilder retten und schlägt dem Kevelaerer Wallfahrtsrektor vor, die Nationalembleme ins Unverfängliche zu verändern, notfalls könne er die Szenen in den Dreißigjährigen Krieg verlegen. Pastor Peter Kempkes, auf Stummels Seite, muss dem Druck nachgeben, als auch der Bischof von Münster darauf besteht, dass die Elendsbilder übertüncht werden. 1918 werden die Stummel/ Cürvers- Wandbilder unsichtbar gemacht (Der Lusitania-Skandal).
Es ist das letzte Lebensjahr von Friedrich Stummel. Monatelang ist er krank, dann ereilt ihn ein Schlaganfall, in dessen Folge Stummel Mitte September 1919 in Kevelaer stirbt. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof im Marienpark.
Die gerade begonnenen Gewölbemalereien im Chor der Basilika werden nach Stummels Tod unter Leitung von Heinrich Holtmann in enger Zusammenarbeit mit Karl Wenzel fortgeführt. Holtmann nimmt zum Teil gravierende Änderungen der Pläne vor.
Mit dem Tod Stummels bricht die Leitfigur weg, der Garant für Aufträge, von denen inzwischen Dutzende Künstler in Kevelaer profitieren. Zusätzlich beschwert durch die Not der Nachkriegsjahre, erfasst viele Künstler Existenzangst. Sie schließen sich 1920 zum „Kevelaerer Künstlerbund“ zusammen, der als Berufsverband dem drohenden Auftragsmangel entgegenwirken soll. Aber die Zeichen sind nicht günstig. Das Generalvikariat kündigt bereits an, weitere Ausmalungen der Basilika zu den bis dahin vereinbarten Kosten nicht mehr zu genehmigen. Es werden preiswertere Materialien eingesetzt (z.B. Schlagsilber statt Blattgold).
1925 malt Heinrich Holtmann die Nischen unter den zugemauerten Apsisfenstern der Basilika mit Engelfiguren aus. Als diese Arbeiten 1926 beendet sind, ist die Basilikaausmalung nach 35 Jahren zunächst abgeschlossen. Mit der Vollendung der von Stummel begonnenen Ausmalung der Beichtkapelle durch seine Schüler und - 1936 - mit dem Entwurf des Malers Ludwig Baur (Telgte) für das Westfenster im Südquerhaus der Marienkirche („Maria Mittlerin der Gnaden“) endet die große Stummel-Zeit in Kevelaer.
Stummels Bedeutung für Kevelaer manifestiert sich nur zu einem Teil in den farbenprächtigen Historienmalereien der Gotteshäuser am Kapellenplatz. Der Maler schafft die Grundlagen für das Charisma der modernen Wallfahrtsstadt, die sich heute auch als „Stadt der Kunst und des Kunsthandwerks“ definiert. Erst das künstlerische Element, dem Einmaligkeit inne wohnt, begründet überzeugend den „Unverwechselbar“-Slogan.
Stummels mindestens 59 Schüler und weitere Kunstschaffende und Kunsthandwerker, die der Ausnahme-Künstler anzog, legten das human capital an, das sich verzinst und in die zweite oder dritte Generation übertragen hat. Von diesem Kapital zehrt der Ort fortdauernd. Die heutige Ansammlung von künstlerisch und kunsthandwerklich Tätigen in Kevelaer ist durchaus vergleichbar mit der zu Stummels Zeiten, gleichwohl, ihr fehlt die Leitfigur eines Stummel.
Er war vielleicht der bedeutendste Künstler, der je in der Marienstadt gewirkt hat.
|
|
|
|